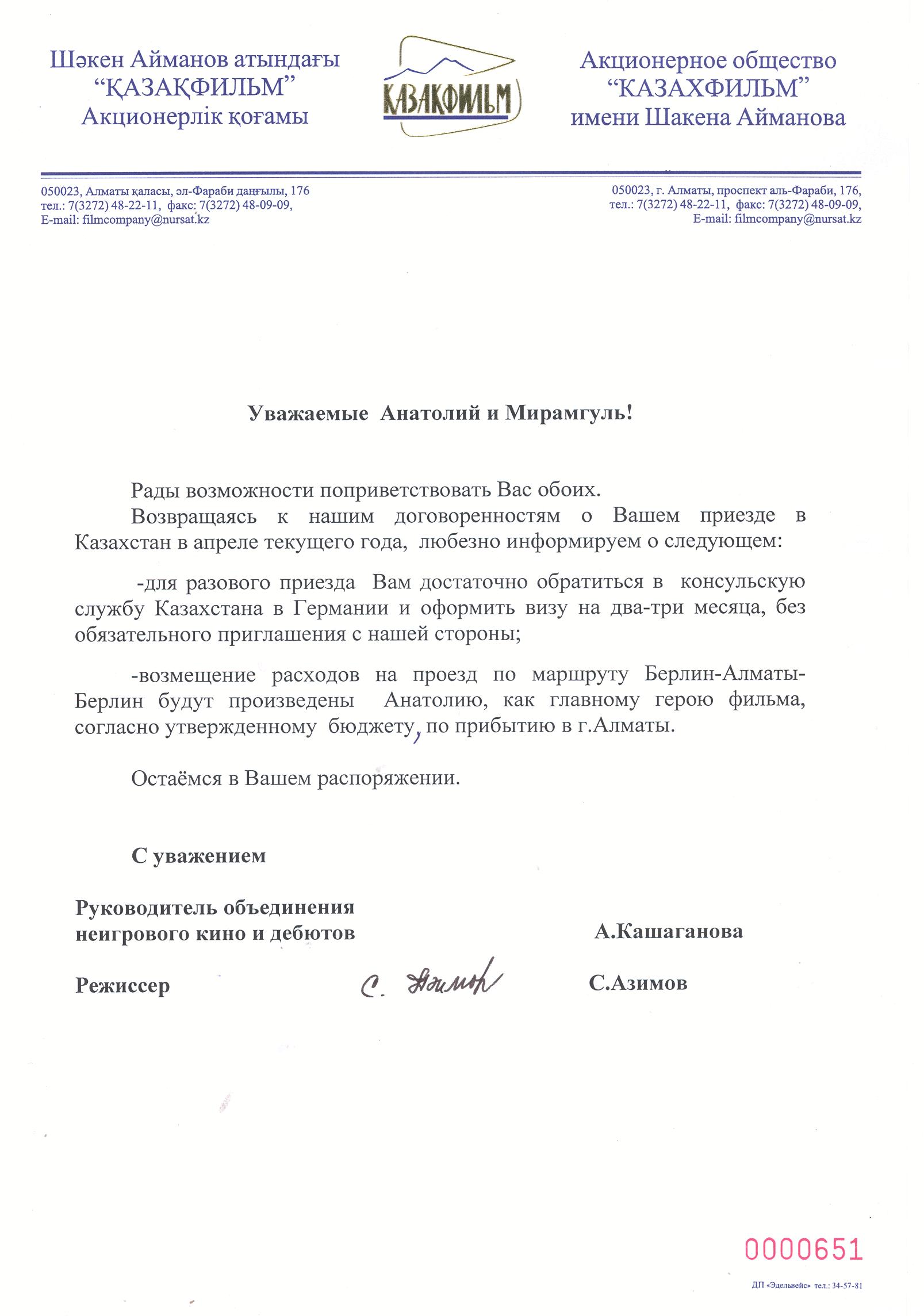Resümee
Ein deutscher Arbeiter, mein Großvater, versteckte vor den Nazis eine sowjetische Fahne. Die Polizei machte Haussuchungen, verhafteten ihn ein paar Mal, fand die Fahne nicht.
Als die Rote Armee sich der kleinen Stadt kämpfend nähert, holt er sie aus dem Versteck und geht mit der erhobenen Fahne den sowjetischen Soldaten entgegen. Es war der 8. Mai 1945, der letzte Tag des Krieges.
Diese Begegnung wurde gefeiert, Soldaten und Offiziere kamen ins Haus des Großvaters, der neun Kinder hatte. Sie halfen der Familie mit Lebensmitteln. So traf eine seiner Töchter, meine Mutter, den Oberleutnant Amentai Nuralijew.
Es kam, was kommen mußte, meine Mutter wurde schwanger. Der Oberleutnant wurde angezeigt, weil ein Verhältnis mit einer Deutschen den stalinistischen Regeln widersprach. Sein Kommandant, der russischer Major Nikiforow, half ihm. Er gab ihm Urlaub mit dem Auftrag, mit einer Kasachin zurückzukehren. So geschah es. Amentai heiratete Anipa, eine Kasachin aus seinem Aul.
Bevor sie in ihre kasachische Heimat in der Nähe der Stadt Kysylorda zurückkehrten, besuchten beide meine Mutter im Krankenhaus, ich war gerade geboren.
Amentai hatte einen Sohn! Er soll Amanbol (Lebe! Lebe gesund!) heißen. Eine Woche später überlegte er, dass diesen Namen niemand kennt, der Sohn eventuell Schwierigkeiten damit bekommen könnte und änderte ihn in Anatoly. Amentai fuhr mit seiner Frau nach Hause – das war des Ende des ersten Teils.
In der DDR ging ich zwei Mal in die sowjetische Botschaft. Beim ersten Versuch wurde ich gar nicht erst vorgelassen, beim zweiten Mal gab es einen anderen Anlaß. Als ich zum Schluß die Frage nach meinem Vater stellte, wurde ich hinausgeworfen.
In Vorbereitung meines 50. Geburtstags 1996 fragte ich mich, was ich im Leben noch erreichen möchte. Und da stand die Frage der Suche nach dem Vater. Ein Jahr später hatte ich Klarheit. Der Vater war 1992 gestorben, in Kasachstan leben neun Töchter von ihm, meine Schwestern. Sie wußten vom Bruder in Deutschland, nun hatte er sich gemeldet. Der erster Besuch war eine denkwürdige Begegnung.
Bei der Rückkehr nach Berlin beschloß ich, in Berlin Kasachen zu suchen. Ich wurde im Jahr 1999 Mitglied der Deutsch-Kasachischen Gesellschaft.
Die Familienbesuche wurden mehr und mehr Normalität. Ich lernte eine Kasachin kennen, Miramkul, wir heirateten.
Alle in meiner Umgebung, selbstverständlich auch die Mitglieder der Deutsch-Kasachischen Gesellschaft, sprachen davon – geh nach Kasachstan, lebe mit Deiner Familie und mit Deiner Frau zusammen!
Es gibt kulturelle Unterschiede zwischen der zentralasiatischen und der deutschen Lebensform. Das hatte ich noch nicht richtig begriffen. Nach und nach wurde deutlich, dass die kasachische Führungsschicht mich nicht im Lande haben wollte. Verschiedene Versuche, Fuß zu fassen, wurden rigoros unterbunden. Selbst die Beschäftigung bei deutschen Unternehmen in Kasachstan wurde verhindert.
Als nun alles zu scheitern drohte, schrieb ich dem kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew einen Brief. Er hat ihn nicht beantwortet.
Schweren Herzens blieb mir nichts anderes übrig, als mich wieder auf ein Leben in Berlin einzurichten. Enttäuschung, Scheidung – Ende des zweiten Teils.
Kasachstan ist ein muselmanisches Land, die Familie gilt als heilig. Beim einfachen Volk habe ich das erlebt, die Menschen fielen uns um den Hals, wenn sie hörten, dass ich mich zu ihnen bekannte und mit ihnen leben wollte. Die Führungsschicht ließ das alles kalt. Heute sehe ich, wenn ich meine Geschichte erzähle, dass Kasachen sich dafür schämen. Ich tröste sie dann.
Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich wieder aufrichtete, Freunde, Bekannte und der Sport halfen.
Ab Sommer 2010 habe ich mich darauf eingerichtet. Zwar habe ich noch weiter Kasachinnen getroffen, mit denen mir eine Partnerschaft denkbar gewesen wäre, die mich auch erwartungsvoll ansahen, aber ich als unerwünschte Person für die kasachische Führungsschicht wollte nicht noch weitere unglücklich machen. Darauf wäre es ja hinausgelaufen. Ich hatte die Lektion gründlich gelernt.
Grundsätzlich ist noch zu erwähnen – aus Kasachstan sind fast eine Million ethnischer Deutsche nach Deutschland ausgereist, sind hier eingegliedert worden. Kasachstan war und ist nicht in der Lage und nicht gewillt, eine menschliche Lösung in diesem einzigen Fall auch nach 18 Jahren nur in Erwägung zu ziehen.
Manchmal denke ich, es müßte doch wenigstens einen in diesem riesigen Apparat in Astana geben, der die menschliche Dimension erkennt. Nein, gibt es nicht. Das zeigt den Entwicklungsstand des Landes, weshalb ich meine ausführlichere Erzählung „Das Khanat“ betitelte.
1. Meine Mutter und mein Vater konnten wegen der damals stalinistischen Verhältnisse nicht zusammen leben, ich konnte es 60 Jahre später mit meiner kasachischen Frau wegen der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse in Kasachstan ebenfalls nicht.
2. Ich wurde daran gehindert, meine Aufgabe als Familienoberhaupt zu erfüllen.
Und so habe ich, das ist der dritte Teil der Geschichte, als ich 2014 andere Russenkinder traf und sah, wie manche nicht wußten, wie sie mit ihrem Schicksal umgehen können, einen Verein gegründet, der Hilfe und Unterstützung für sie anbietet. Aber auch hier hilft Kasachstan selbstverständlich nicht. Vielleicht ist es gerade deshalb ein Erfolg geworden.
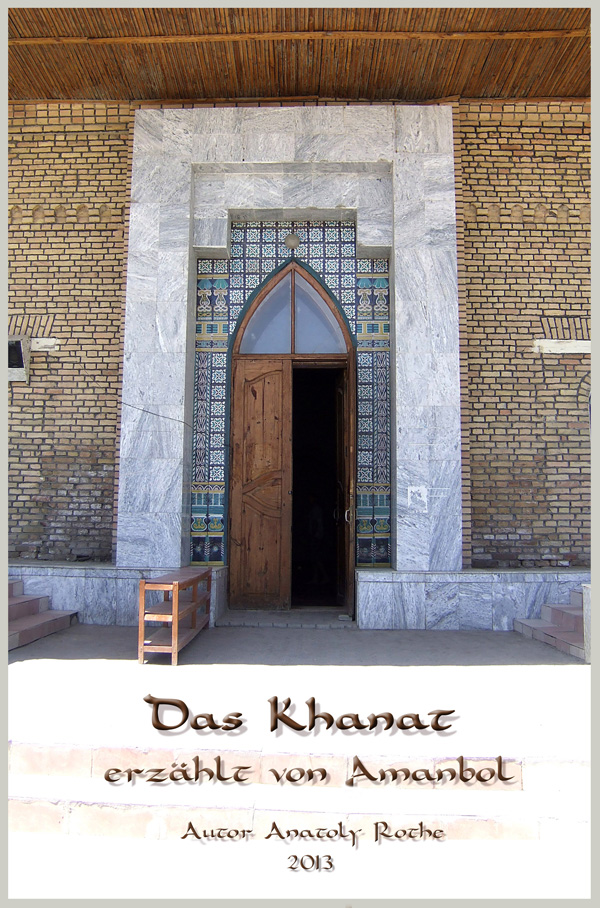
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel Das Erbe des Vaters
3. Kapitel Reise zum Issyk Kul
6. Kapitel Ein Film soll entstehen
7. Kapitel Die Khane zeigen ihr Gesicht
Photos: Der Autor
Bildbearbeitung und Einbandgestaltung: Dr. Eva-Maria Zschorn
Viel Vergnügen
Kommentare sind erwünscht.
Platon_57b
7. 1. 2012
Diese Geschichte beruht auf Tatsachen. Selbstverständlich schleichen sich subjektive Merkmale mit in die Erzählung, jedoch versucht der Chronist, sich an die Abläufe zu halten.

Ich lehnte mich im Flugzeug in meine Lehne, blickte aus dem Fenster, schnallte mich an. Mein Nachbar war ein junger Mann. Es begann das übliche Prozedere der Startvorbereitungen.
Eine mandeläugige Stewardess zeigte die Anschnallutensilien hoch, mit der Hand folgte sie den am Boden eingelassenen bunten Lichtern, zeigte auf die Notausstiege. Schließlich kontrollierten sie und ihre Kolleginnen noch einmal die Anzahl der Passagiere und ob sie angeschnallt waren. Der Lärm schwoll an, die Maschine hob ab in die Lüfte.
Das erste Mal im Leben flog ich im Jahr 1959 als ich 13 Jahre alt war. Ich war Kadett, trug Uniform, hatte alles Militär zu grüßen und stand an der untersten Stufe der Hierarchie. Selbstverständlich waren wir eine Elite, wir wussten es jedoch nicht, jedenfalls ich nicht.
Meine Familie stammt aus dem Osterzgebirge. Meine Mutter hatte 1953 einen Aufnahmeleiter vom Dokumentarfilm geheiratet und war nach Berlin gezogen. Im gleichen Jahr holten sie mich von den Großeltern nach Berlin und ich wurde eingeschult. 1958 meldete mich meine Mutter an dieser Kadettenschule an. Ich nahm an einem Auswahlverfahren teil, einer von über Tausend. Sport, Mathematik, Deutsch und weitere Allgemeinbildung. 52 wurden zugelassen, zwei Klassen – bei uns Züge – wurden gebildet.
In den Ferien fuhr ich gewöhnlich ins Erzgebirge zu den Großeltern. Einmal kam meine Mutter mich dort abholen. Wir fuhren mit dem Bus nach Dresden, holten im Stadtbüro der Fluggesellschaft die Tickets ab und fuhren weiter auf den Dresdner Flughafen. Ich war beeindruckt. Eine IL-12 mit großen Propellern nahm uns auf, donnerte über das Flugfeld, hob ab und nahm Kurs Richtung Berlin. Die Iljuschin lag unruhig in der Luft, hob und senkte sich überraschend. Ich genoss das Ganze aus dem Fenster schauend. Leider war die Strecke und das Flugvergnügen nur kurz. Im Grunde genommen bestand der Flug aus zwei Phasen, steigend, Höhe gewinnend, danach Abstieg zur Landung. Das war mein erster Flug, er ist unvergessen. Meine Mutter konnte 14 Tage danach nicht arbeiten gehen. Ihr war der Flug nicht bekommen.
Jetzt saß ich in einem Airbus der Mongolian Airlines, flog nach Moskau, dort wollte ich umsteigen und nach Almaty weiter fliegen. Es war das Jahr 1999. Neben mir saß ein junger Arbeiter aus Ostdeutschland, der in der mongolischen Provinz nach Erzen grub. Er erzählte von seinem Einsatz, der Einsamkeit in den Weiten des Landes, von den Mädchen dort. Im Grunde genommen trafen westeuropäische Arbeitsnomaden auf innerasiatische eingeborene Nomaden. Es gab große Unterschiede, das unstete Leben vereinte sie.
Bald erschöpfte sich das Thema und ich sah auf die dunkler werdende Erde herab.
Moskau-Scheremetjewo 1. Ich verabschiedete mich von meinem Flugnachbarn und wir wünschten uns gegenseitig alles Gute. Ein Teil der Passagiere, so auch ich, stiegen aus.
An der Passkontrolle gab es einen kleinen Auflauf. Nach einigen Minuten reichte ich einer schönen russischen Grenzbeamtin meinen Pass. Ich strahlte sie an, sie war wirklich eine Schönheit. Ich setzte zu einem Kompliment an, längst vergessene russische Vokabeln hervorkramend, die grammatische Form suchend, übernahm sie die Gesprächsführung. „ Sie haben kein gültiges Visum.“ Ein Satz wie ein Schwerthieb. Ich lächelte sie an und entgegnete: „Hier sehen Sie! Hier ist mein Visum. Ich will weiter nach Almaty.“ Ich glaubte zunächst, dass mein Visum nicht für Russland gültig sei. Diese Frage stand aber nicht. Sie zeigte auf das Datum und sagte: „Ja, ich sehe es. Es beginnt am 10. 8. Wir haben heute aber noch den 9. 8.- 20 Uhr. Also haben sie für die nächsten Stunden kein gültiges Visum.“ Ich blickte auf den Stempeleintrag im Pass, ja sie hatte recht. Aber das war ja natürlich so. Mühsam versuchte ich ihr zu erklären, dass ich zu meinem ersten Besuch nach Almaty fliegen wollte, ich ein Ticket für die österreichische AUA über Wien hatte und diese Maschine nicht nach Berlin gekommen war, so dass ich eine Möglichkeit mit Mongolian Airlines nutzte, um einigermaßen pünktlich noch nach Almaty zu gelangen. „Zeigen Sie mir bitte Ihr Ticket!“ Da schoss es mir durch den Kopf, dass jetzt Schwierigkeiten beginnen werden. Ich zeigte ihr ein weißes A4-Blatt, auf dem mit Hand ein Eintrag stand. Sinngemäß: Wir bitten alle beteiligten Airlines, diesem Passagier zur Erreichung seines Flugziels Almaty behilflich zu sein. Die Kosten übernimmt die AUA. Bekommen hatte ich es in Berlin von einer AUA-Stewardess, die mich über Moskau umgeleitet hatte. Eigentlich sollte ich erst am nächsten Tag fliegen, aber ich bestand darauf, noch am gleichen Tag abzufliegen. Der Grund war einfach. Ich wollte auf gar keinen Fall meinen ersten Besuch in Almaty mit Verspätung beginnen.
„Das ist doch kein Flugticket, Setzen Sie sich dorthin!“ Sie begleitete mich zu einer Bank, wies energisch mit der Hand darauf. Ich setzte mich, was sollte ich sonst tun. Sie verschwand hinter einer Tür. Ich blickte ihr hinterher und sah, ihre Uniform saß wie angegossen. Was erwartet mich jetzt?
Ich sah auf meine Uhr. Es war gegen 20 Uhr. Die Maschine nach Almaty sollte gegen 23 Uhr von Scheremetjewo 2 fliegen. Nach einer Weile kam sie zur Tür heraus und setzte sich zu mir. Sie hatte ein Formular dabei, in welches sie im Laufe der Unterhaltung Notizen eintrug.
„Sie heißen?“ Ich sagte meinen Namen. „Woher kommen Sie? Wohin wollen Sie? Weshalb wollen Sie nach Almaty? Warum haben Sie kein gültiges Visum?“ Derartige Fragen waren für mich zunächst wegen der Sprachschwierigkeiten schlecht zu verstehen. Deshalb begann ich mit den Vokabeln, die mir inzwischen wieder eingefallen waren, die Umstände meiner Reise mehr schlecht als recht zu erklären. Manchmal fragte sie nach, wahrscheinlich, weil mein Russisch katastrophal war. Schließlich hatte ich 1965 die Schule beendet und seither wurde die russische Sprache von mir nicht mehr verlangt. Und so erzählte ich ihr in groben Zügen meine Geschichte.
Diese ging so:
Ein deutscher Arbeiter, mein Großvater, gab einer Delegation, die Anfang der 30-er Jahre des 20. Jahrhunderts in die Sowjetunion fuhr, eine rote Fahne mit. Die Delegation kehrte nach einigen Wochen im Sowjetland wieder nach Dresden zurück. Die Nazis übernahmen 1933 die Macht. Die sowjetischen Arbeiter hatten die Fahne gegen eine der ihrigen eingetauscht. Sie war aus Seide, mit goldenen Bordeln, der Inschrift: Proletarii wsech stran - sojedinjeites! und einem großen Sowjetemblem in der Mitte. Diese Fahne wurde dem Großvater übergeben und er bewahrte sie die ganze Zeit der Naziherrschaft über auf. Die Polizei machte Haussuchungen, sperrte den Großvater einige Male ein, die Fahne hat sie nicht gefunden. Und als nun im Mai 1945 die Rote Armee sich dieser kleinen sächsischen Stadt näherte, holte der Großvater die Fahne aus dem Versteck und ging mit ihr den Soldaten entgegen.
Das war für alle Beteiligten ein großes Fest. Nach vier Jahren Krieg, nach vier Jahren unendlichen Leides, welches die Deutschen über die europäischen Völker gebracht hatten, einen Tag vor dem Ende des Krieges, da tritt den Soldaten ein deutscher Arbeiter mit einer sowjetischen Fahne entgegen.
Es wurde ein Fest organisiert. Soldaten und Offiziere der Roten Armee kamen in das Haus des Großvaters. Es gab Brot, Speck und all das, was zu einer typisch russisch ausgerichteten Feier gehört. Selbstverständlich wollten die Toaste nicht enden. Auf den Sieg! Auf Stalin! Auf den Großvater! und so weiter.
In dieser Zeit erhielt der Großvater mit seiner Familie, also Frau, neun Kindern und einer Reihe von Enkelkindern Lebensmittel von der Armee. Es war nicht viel, half aber zu leben. Und auf diese Weise gelangte der Oberleutnant Amentai Mustapajewitsch Nuralijew ebenfalls in das Haus des Großvaters. Eine seiner Töchter, meine Mutter, und der junge Oberleutnant begannen das, was die jungen Menschen zu allen Zeiten und in allen Völkern taten, sie begannen sich zu mögen.
Sommer, Herbst und Winter des Jahres 1945 vergingen. Als im nächsten Jahr der Schnee taute, spürte meine Mutter unter ihrem Herzen etwas heranwachsen, ein Kind, mich.
Die Besetzung der Kommandantur durch die Rote Armee war nur klein, ein russischer Major als Kommandant, der besagte Oberleutnant, ein paar Soldaten, einige Schreiberinnen. Amentai war ein großer, schlanker, hübscher Mann. So blieb es nicht aus, dass die Schreiberinnen ebenfalls ein Auge auf ihn warfen. Nun hatte er sich mit dieser Deutschen eingelassen. Irgendjemand meldete das einer vorgesetzten Stelle. Gab es unmittelbar nach der Besetzung in den ersten Tagen Übergriffe auf die deutsche Zivilbevölkerung, wurde das sehr schnell unterbunden. Stalin erließ strenge Befehle, die eine Fraternisierung mit der deutschen Bevölkerung, aber ebenso jegliche andere Arten der Annäherung unterbanden. Somit entwickelte sich die Sache zu Ungunsten des Oberleutnants. Sein Kommandant rief ihn zu sich. „Amentai, Du hast den ganzen Krieg mitgemacht, wurdest verwundet, bist anständig geblieben. Es liegt eine Anzeige gegen Dich vor. Ich gebe Dir Urlaub, Du fährst nach Hause und kommst mit einer Frau aus deinem Aul wieder hierher zurück. Ihr werdet hier heiraten, Du wirst demobilisiert und die Sache ist für Dich beendet!“
Der Oberleutnant war verzweifelt. Wenn ihm der Kommandant nicht hilft, ist er verloren. Er sprach mit dem Großvater darüber. Der antwortete ihm:“ Bleib ruhig! Mach keine Dummheiten, mach, was der Major gesagt hat.“ Alle hatten verstanden, es hatte genug Leid gegeben, als das jetzt durch eine solche Geschichte noch eines hinzugefügt werden sollte.
Der Oberleutnant fuhr wie befohlen nach Hause. Es war ein Aul in der Steppe in der Nähe der Stadt Kysylorda. Was sollte er tun? Welche von den jungen Frauen konnte er unter solchen Umständen fragen? Er ging zu Anipa, manchmal hatte er schon vorher daran gedacht, Anipa zur Frau zu nehmen. Das war unter anderen Umständen gedacht. Nun kam er zu ihr mit einer Bürde, mit einem Abenteuer, welches erst ausgestanden war, wenn es wirklich zu Ende war. Bis dahin konnte noch allerlei passieren.
Die Liste der Toten durch den Krieg, die im Aul geführt wurde, war lang, sehr lang. So hatten nur wenige der jungen Männer den Krieg überlebt und kehrten nun langsam nach Hause zurück. Anipa sagte zu. Gemeinsam wurden die Hochzeitsvorbereitungen getroffen. Sie packten ihre Sachen und fuhren über 4000 km nach Deutschland. In der kleinen sächsischen Stadt angekommen, richteten sie sich notdürftig ein. Der Oberleutnant wurde in die nächstgrößere Garnison versetzt, 30 km entfernt. Anipa und er kamen ins Krankenhaus, um meine Mutter und mich zu sehen. Ein Sohn - was kann es Schöneres für einen Mann aus Zentralasien geben als einen neu geborenen Sohn. Sie nahmen mich auf den Arm, liebkosten mich, den ein paar Tage alten Säugling. Der Oberleutnant wollte mich Amanbol nennen. Namen haben eine Bedeutung. Amanbol heißt - Lebe, lebe gesund! Aber ein paar Tage darauf entschied er sich anders. Wenn sein Sohn größer wird und niemand diesen Namen kennt und versteht, trägt sein Sohn einen Makel. Er dachte an die Macht, die ihn dazu zwang, seinen Sohn allein in Deutschland zurückzulassen. Einer solchen Gefahr wollte er ihn nicht aussetzen.
Die Heirat wurde in der großen Garnisonstadt vollzogen. Der Oberleutnant machte Dienst, fuhr ab und zu zu seinem Sohn. Meine Mutter wusste nicht um die Vorgänge. Eines Tages kam er nicht mehr.
Als ich größer wurde, sprach niemand mit mir über meinen Vater. Nur einmal rutschte einer meiner Tanten eine Bemerkung heraus. Ich war 16 Jahre alt. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging, nur sagte sie einen Namen, Noralijew. Da wurde mir klar, dass ich mir den merken musste, schließlich hieß mein Vater so.
Irgendwann in den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte ich den Mut aufgebracht, in die Sowjetische Botschaft zu gehen und nach meinem Vater zu fragen. Ich wurde erst gar nicht vorgelassen. 1986 flog meine damalige Lebensgefährtin nach ihrer Promotion für ein halbes Jahr nach Moskau. Sie wohnte und arbeitete in der MGU, der Moskauer Universität. Da hatte sie ein kleines Zimmer, das danebenliegende wurde frei und sie meinte, ich könne für 14 Tage zu ihr kommen. Also ging ich in die Sowjetische Botschaft, fragte nach einem Visum. Es fühlte sich niemand dafür zuständig. Ich nutzte die freundliche Absage zu der Frage nach meinem Vater. Der Diplomat lief rot an, wurde laut, brüllte „Raus! Raus!“. Zugleich drückte er unter seinem Schreibtisch einen Knopf, die Tür öffnete sich und ein energisch aussehender Mann nahm mich mit hinaus. Nach Moskau bin ich geflogen, es war der 9. Mai 1986. Wer sich an das Datum erinnern kann, es war ca. eine Woche nach den Ereignissen in Tschernobyl.
So hatte ich eigentlich keine Hoffnung mehr, meinen Erzeuger zu finden.
Die DDR brach zusammen, im Osten änderte sich die Welt. Als ich nun vor meinem 50. Geburtstag darüber nachdachte, wie ich mein weiteres Leben gestalten möchte und was ich noch erreichen will, entschloss ich mich, noch einmal die Suche nach dem Vater aufzunehmen. Einmal noch wollte ich es versuchen. Wenn es jetzt keine Antwort darauf gibt, ist es eine Schicksalsfügung.
Ich ging nunmehr in die Russische Botschaft. Dort verwies man mich an das Konsulat. Ich betrat das russische Konsulat, es befindet sich an der Rückseite des Botschaftskomplexes. Es war ein großer Raum. Ungefähr 25 Leute standen an den Wänden und Fenstern und warteten offensichtlich. Die Warteschlange dagegen war nicht sehr groß, nach kurzer Zeit stand ich vor einer Scheibe. Der Konsularbeamte drückte auf einen Knopf, über den Lautsprecher fragte er mich, was ich wolle. Der Lautsprecher war sehr laut, alle im Raum hörten seine Stimme. Ich antwortete, dass ich meinen Vater suchen möchte. Er war in der Roten Armee. Er fragte zurück: "Ihren Vater suchen Sie?" Ich sah mich kurz um, alle drehten sich zu mir und blickten mich an. - Da stand ein 50-jähriger, der seinen Vater in Russland sucht.
Ich wendete mich wieder dem Beamten zu und sagte: "Ja, ich möchte meinen Vater suchen. Er war 1946 in der sowjetischen Armee."
"Hier haben Sie die Adressen der deutschen Botschaft in Moskau und vom Militärarchiv in Podolsk bei Moskau. Wenden Sie sich dahin!" Eine Klappe öffnete sich und ich hielt einen schmalen Zettel in der Hand. Ich verließ sehr schnell den Raum, die Blicke der Anderen im Rücken.
Ich schrieb nach Moskau an die Botschaft, wurde von dort um nähere Angaben gebeten. Dieser Brief bereitete nicht viel Hoffnung, schrieb mir doch der Beamte, dass es lange dauern würde und ohne Ergebnis enden könne, da sehr viele Soldaten und Offiziere in Deutschland stationiert waren und er unbedingt genaue Angaben benötige, um helfen zu können.
Nach Rücksprache mit meiner Mutter schrieb ich auf, was ich gelesen und gehört hatte. Ich erinnerte mich an das Gespräch mit meiner Tante Doris. Die Kommandantur in der kleinen sächsischen Stadt war nur mit wenigen Angehörigen besetzt. Ich machte mir Hoffnungen.
Am Ostersonnabend 1997 kam ich vom Einkauf nach Hause und öffnete den Briefkasten. Da ich schon fast ein halbes Jahr nichts mehr von der Sache gehört hatte, dachte ich nicht mehr daran. Im Kasten lag ein dicker C5-Umschlag, der Absender war die deutsche Botschaft in Moskau. Ich wusste sofort, dass sie ihn gefunden hatten. Wenn sie nichts gefunden hätten, wäre der Umschlag dünn. Da er dick war, konnte es sich nur darum handeln, dass sie mir Unterlagen zuschickten. Ich riss ihn auf und hielt amtlich abgestempelte Papiere des Militärarchivs und die deutschen Übersetzungen der Botschaft in der Hand. Ebenso ein Foto eines jungen Mannes, dem die Haare ab rasiert waren. Ich stürzte in meine Wohnung, rief meine Mutter an und erzählte es ihr. Ohne zu zögern fuhr ich sofort mit dem Auto zu meiner Mutter. „Ja, er ist es!“
Wir waren beide erschüttert. Es ist für mich schwierig, diesen Zustand zu beschreiben. Ich begann, einen leibhaftigen Vater zu bekommen. Er bekam ein Gesicht und ich die Auskunft, dass er aus Kysylorda war.
Was sollte ich mir darunter vorstellen? Das Bild des jungen Mannes ohne Haare brachte Mama zu der Frage: Wo sind seine schönen Haare geblieben?
Ich verlor meine innere Ruhe.
Ich schrieb ihm sofort einen Brief an die letzte Adresse von 1969, als seine Unterlagen aus dem Archiv für aktiven Dienst herausgenommen wurden: Kysylorda, Altynsarina.
Eine Bekannte bat ich, einen Aufkleber zu übersetzen, auf dem die Bitte stand: Wenn der Adressat dort nicht mehr wohnt, diesen Brief an seine neue Adresse weiterzuschicken oder seinen Angehörigen zu übermitteln.
Ebenso schrieb ich , wie die deutsche Botschaft in Moskau empfahl, nach Almaty an die deutsche Botschaft. Von dort erhielt ich sehr rasch eine erste Antwort. Sie leiten das Gesuch weiter an die zuständigen Behörden. Eine Antwort erwarten sie von denen eigentlich nicht. Wenn es eine geben sollte, wird es wohl sehr lange dauern.
Es kam noch ein Satz, der mich heute noch, sarkastisch gesagt, zum Lachen bringt. Sie wiesen darauf hin, dass, wenn sie die entsprechende Person gefunden haben, sie, also die deutsche Botschaft Almaty, darauf aufmerksam machen werden, dass keinerlei Auskunft gegeben werden muss. Mein Vater könne also selbst entscheiden, ob er antwortet oder nicht. Der deutsche Datenschutz verlange diese Aufklärung.
Viele Monate später erhielt ich mit einem Anschreiben der Botschaft eine Seite des dortigen Innenministeriums, auf der die Suche nach Amentai Nuralijew geschrieben stand und handschriftlich auf der unteren Hälfte vermerkt war:
Lieber Bruder, wir sind sehr glücklich, dass Du uns gefunden hast. Verliere uns nicht aus den Augen! Schreibe! Wir warten darauf! Unterschrift: Mira Nuralijewa und ihre Adresse in Kysylorda.
Ich schrieb sofort einen Brief an Mira, indem ich über mich berichtete. Es kam der erste Brief von Mira. Er begann so: Lieber Bruder, bevor Du diesen Brief liest, setze Dich hin und fasse Dich!
Sie schrieb, dass der Vater 1992 gestorben war. Seine Frau Anipa war schon eher verstorben. Sie begann mit der Nummer 1 die Geschwister aufzuzählen. Auf der ersten Seite ging es bis drei. Ich blätterte bis zum Ende und sah als letzte die Nummer 9. Ich begriff, ich bekam gerade 9 Geschwister. Beim näheren Hinsehen konkretisierte es sich auf 9 Schwestern, kein Bruder war dabei. Ich war fassungslos. Bisher hatte ich keine Geschwister, war der einzige Sohn der Mutter. Jetzt mit einem Schlag erhielt ich im Alter von 50 Jahren 9 Schwestern!
Ich war überwältigt. Es hat ungefähr 14 Tage gedauert, bis ich wieder meine normale Gemütslage zurückgewonnen hatte.
Eines Tages klingelte das Telefon. "Hier ist Rimma. Kann ich Dich besuchen kommen? - Ja, selbstverständlich.
Zwei Wochen später fuhr ich mit Eva, der ungefähr 7 Jahre alten Enkelin meiner damaligen Lebensgefährtin, zum Flughafen Berlin-Schönefeld.
Die Passagiere der Maschine kamen aus dem Transitbereich durch eine Tür heraus. Es waren nicht sehr viele. Es kam eine kleine Kasaschka und blickte sich suchend um. Da wusste ich, das ist meine Schwester Rimma. Mein Herz schlug schneller. Es bedurfte keinerlei Erklärungen, sie musste es sein und sie war es. Wir umarmten uns, für mich ein unvergessener Augenblick. Ich hielt das erste Mal eine Schwester im Arm.
Ich habe sie "Smelaja" getauft. Sie flog nach Berlin zu ihrem Bruder ohne etwas richtig von ihm zu wissen. Das fand ich mutig.
Dabei gab es eine Überraschung. Ich habe schon von klein auf an die Gewohnheit, Leuten eine Bezeichnung zu geben. Eva zum Beispiel war die "Spille". Der Ausdruck kommt aus dem Sächsischen und mit spillrig bezeichnet man dünne Menschen. Eva war dünn, also nannte ich sie Spille. Der Begriff setzte sich durch und sie heißt heute noch so. Die Überraschung bestand darin, dass Rimma mir erzählte, dass der Vater ebenso diese Gewohnheit hatte. - Man stelle sich das vor, ich habe ihn gesehen, als ich einige Tage alt war, danach nie mehr. Aber eine solche Gewohnheit bei uns beiden - das war unglaublich. Rimma zählte noch einige solcher Übereinstimmungen auf. Wenn ich mich wasche, schnaufe ich - wie der Vater, Ich bin gewöhnlich ein fröhlicher Mensch - wie der Vater. Ich lache gern auf meine Art - wie der Vater. Meine Haare auf den Armen - wie der Vater. So ging das weiter. Mich hat das sehr gefreut, ich war froh, dass es solche Ähnlichkeiten gibt. Genauer gesagt, ich war glücklich. Was für ein Glück es geben kann!
Rimmas Besuch in Berlin war ein Fest. Wir zeigten ihr Berlin, besuchten das sowjetische Ehrenmal in Treptow, von dem ich nicht weit entfernt wohne und das ich mehrmals im Jahr besuche. Selbstverständlich besuchten wir Mama und ihren Mann, der inzwischen verstorben ist.
Von Rimma erfuhr ich die Probleme, die der Vater in Deutschland hatte und wie sie mit Hilfe des Kommandanten gelöst worden waren. Die Mutter hatte mit den Töchtern darüber gesprochen, dass sie einen Bruder in Deutschland hatten. Sie wussten es. Aber warum hatte der Vater nichts unternommen?
Zuerst durfte niemand wissen, dass er überhaupt einen Sohn in Deutschland hatte. Als sich die politische Situation langsam besserte, hatte er mit der Familie genug zu tun. Als er zur Tat schreiten und nach Deutschland reisen wollte, wurde er krank und konnte eine solch lange Reise nicht mehr unternehmen.
Selbstverständlich bereisten wir im Osterzgebirge die Orte, in denen alles begann. Diese Stätten unter diesen Umständen zu besuchen, löste bei uns Gefühlsregungen aus. Ich kannte sie von klein auf, Rimma bekam eine Vorstellung davon, was für sie bisher mit nur vagen Andeutungen verbunden war.
Mama hatte wohl gehofft, dass der Vater noch lebt und sie ihn noch einmal treffen würde. Das hatte sich nicht erfüllt. Nun sah sie uns, die Kinder, seine und ihr gemeinsames. So unterschiedlich die Lebensumstände waren, wir fanden auf den ersten Blick zusammen. Unsere gemeinsame Zukunft hatte begonnen.
Rimma reiste ab, wir verabredeten, die Verbindung auszugestalten.
Als nächstes meldete sich meine Schwester Mira. Sie arbeitete in Kysylorda bei einer deutschen Ölfirma. Als ihre Chefs davon hörten, dass sich der deutsche Bruder nach so langer Zeit eingefunden hatte, gaben sie ihr drei Wochen Urlaub und die für sie nicht zu bezahlenden Flugtickets. Ich stellte fest, dass sie einen anderen Charakter hatte, ein anderes Temperament. Das ist eigentlich selbstverständlich, bei etwas Überlegung hätte ich es mir denken können, ich war aber ohne Vorstellung davon. Was soll ein Mensch, der unter solchen Konstellationen seine Schwestern kennenlernt, sich vorstellen? Während Rimma ruhig, zurückhaltend wirkte, gab Mira ihren Redefluss frei. Auch zeigte sie mehr Emotionen.
Wir vollzogen das Programm Familie, Berlin, Osterzgebirge.
Nach drei Wochen flog sie wieder ab.
Nun war ich dran, die Schwestern zu besuchen, die ganze Familie, ihre Lebensorte und selbstverständlich das Grab des Vaters zu besuchen. Dazu fand ich in einer russischsprachigen Zeitung in Berlin ein Reisebüro, welches Reisen nach Zentralasien organisierte. So lernte ich Alexej kennen. Er saß in einem Keller in Tempelhof. Ich stieg die Stufen hinab und wurde freundlich empfangen. Alexej spricht deutsch mit starkem Akzent. Ich erzählte kurz meine Geschichte, warum ich nach Almaty fliegen wollte. Er war sichtlich gerührt von unserem Schicksal.
Er stellte die für mich günstigste Route zusammen. Sie sollte mit der AUA über Wien führen. Das Visum für die Reise besorgte er. Als ich die Tickets in der Hand hielt, dachte ich so für mich, sie werden mich zum Grab des Vaters führen.
Die Maschine sollte gegen Mittag fliegen. Meine damalige Lebensgefährtin brachte mich zum Flughafen Tegel. Als ich ankam, wurde ich von einer freundlichen Stewardess empfangen, die mir bedauernd mitteilte, dass die Maschine nicht aus Wien gekommen ist und sie mich bittet, am nächsten Tag zu fliegen. Sofort dachte ich daran, dass in Almaty die Familie auf mich warten wird. Ich wollte deshalb unbedingt noch am gleichen Tag fliegen. Die Stewardess sagte mir, dass sie schon daran gedacht haben, aber keine Fluggesellschaft gefunden haben, mit der sie mir empfehlen können zu fliegen. Es gehen zwar Maschinen, aber die würden sie mir nicht zumuten wollen. Welche? Die Mongolian Airlines. Sie fliegt über Moskau, Abflug ist in zwei Stunden, Ankunft in Almaty eine Stunde später als ihre Maschine.
Ich fliege mit Mongolian Airlines! Sie bat mich um mein Ticket, schrieb auf ein weißes Blatt mit der Hand die Bitte an die anderen um Beförderung ihres Passagiers. Zwei Stunden später saß ich in der Maschine nach Moskau.
Die schöne Grenzbeamtin sagte, ich solle warten. Ich fragte nach der Maschine nach Almaty. Keine Sorge, Sie werden sie bekommen. Nach kurzer Zeit kam sie zurück: Sie zahlen eine Strafe von 18 Dollar, weil sie kein gültiges Visum besitzen. Sind Sie einverstanden? Ja, selbstverständlich.
Wir gingen durch den Flughafen zu einer kleinen Bank. Ich zahlte den Betrag in DM. Wir gingen wieder zurück. Ich sah sie von der Seite an: Straf – eto nemetskoje slowo. Sie lächelte. Was ist mit meinem Koffer? Den holen wir jetzt. Setzen sie sich bitte wieder hier hin. Gleich wird eine Stewardess kommen und sie zu der Maschine nach Almaty bringen. Dadurch, dass sie die 18 Dollar bezahlt haben, wird ein Kleinbus sie von hier durch den Flughafen bringen. Sie brauchen also nicht außen herum zu fahren. Ich wünsche ihnen von ganzem Herzen viel Glück! Werden Sie mit ihrer Familie glücklich! Sie lächelte zum Abschied, was für eine Schönheit! Und wer sie kennt – was für eine Herzlichkeit einer russischen Beamtin!
Eine kleine Stewardess kam, fragte mich nach meinem Namen und nahm mich mit durch einen kleinen Tunnel zu einem Kleinbus. Sie fragte mich, warum ich nach Almaty fliegen möchte. Ich erzählte es ihr. Durch das Gespräch mit der Grenzbeamtin hatte ich ein wenig mehr Übung in Russisch. Als ich endete hatte sie Tränen in den Augen. Was für ein Schicksal! Zum Chauffeur gewandt fragte sie, ob er alles mitbekommen habe. Ich fragte, ob wir die Maschine nach Almaty noch bekommen werden. Selbstverständlich! Diese Maschine wird nicht ohne sie fliegen! Machen sie sich keine Sorgen.
Ich erlebte als völlig Fremder die große russische Seele, ein Mitgefühl, dass von Herzen kam und mir wohl tat.
Der Bus hielt an einer Halle. Die Tür wurde geöffnet, die anderen Passagiere kamen, ich stieg als Erster über die Gangway.
Ich flog zum ersten Male nachts. Die Strecke Moskau – Almaty wollte nicht enden. Vor der Landung gingen die Stewardessen mit kleinen weißen Zetteln durch die Reihen und fragten etwas. An mir gingen sie vorüber. Ich dachte daran, dass jetzt eine neue Ära für mich beginnt, Familie des Vaters, Land des Vaters. Eine Wurzel wird freigelegt.
Die Maschine begann sich langsam nach vorn zu neigen, die Triebwerke liefen nicht mehr auf vollen Touren. Der Landeanflug begann. Die Lichter einer Stadt wurden sichtbar – Almaty.
Die Maschine setzte auf, rollte aus, wendete. Ich sah das erleuchtete Flughafengebäude, abgestellte Maschinen. Wir wurden vom Flugfeld mit einem Bus abgeholt. In der Empfangshalle wartete ich auf meinen Koffer. Er rollte heran. Ich nahm ihn und ging auf den Ausgang zu.
Ich war zwar müde, aber voller Erwartungen. Die Familie wird am Flughafen stehen und mich in Empfang nehmen.
Draußen standen sie, Mitglieder meiner kasachischen Familie. Es wurde eine herzliche Begrüßung. Rimma kannte ich aus Berlin, Sweta und Rosa, standen ebenfalls am Ausgang. Diese drei meiner Schwestern leben in Almaty. Die anderen in Kysylorda, wo der Vater nach der Demobilisierung nach einem kurzen Intermezzo in seinem Aul mit der Familie lebte. Die drei Schwestern gingen nach der Schule nach Almaty zum Studium, blieben in der Großstadt und gründeten ihre Familien.
Wir stiegen in einen alten Moskwitsch ein, Anuar, Rimmas Mann, fuhr. Sie wohnten in einem kleinen Haus in der Hadschi-Mukano-Str. Sie befindet sich am Ende der Furmanowa-Straße, die sich lang den Hang, an dem Almaty liegt, hochzieht. Dort warteten noch viele weitere Verwandte, Schwestern, Schwager, Nichten, Neffen. Wir saßen noch eine Weile zusammen.
Es wurde langsam hell.
Aufwachen in Almaty. Für mich war ein einzelnes Zimmer, Lauras Zimmer, Rimmas und Anuars Tochter, reserviert, die Anderen schliefen in Betten, auf Couchs, auf dem Boden. Ich wusste von einem lange zurückliegenden Besuch in Moskau und Leningrad, dass in der großen Sowjetunion solche Verhältnisse natürlich sind. Niemals würde ein Gast abgewiesen werden, weil kein Platz sei. Gäste sind Könige, werden so behandelt, bekommen alle Wünsche erfüllt. Das Beste wird für sie vorbereitet und aufgetragen. Die ganze Familie hilft selbstverständlich dabei, es dem Gast so angenehm wie möglich zu machen. Die Vorbereitungen dauern tagelang. Diese Art der Gastfreundschaft ist selbstverständlich. Nun kam zum ersten Male der älteste Bruder. Da sollte alles ganz besonders schön werden. Es wurde.
Ich erinnere mich daran, dass ich in den nächsten Tagen jeden Tag auf ein oder zwei Einladungen saß. Schwestern und Kinder waren aus Kysylorda angereist, Verwandten und Freunden wurde ich vorgestellt.
Beim allerersten Fest, es fand bei Rimma statt, wurde ich natürlich sofort mit den kasachischen Festgewohnheiten bekannt gemacht. Eine lange Tafel war berstend vollgeladen. Speisen, Getränke, Geschirr und Besteck. Vor dem ersten Toast wurde überall eingegossen, auch ich wurde gefragt, was ich trinken möchte.
Ein Blick genügte mir und ich entschied: Du wirst hier keinen Alkohol trinken. Ich dachte ganz einfach, wenn ich jetzt mit Alkohol anfange, wird es nicht bei einem Glas bleiben. Die Trinksitten in der Sowjetunion hatte ich schon kennen- und auch fürchten gelernt. Das vertrage ich nicht. Mit ein paar getrunkenen Gläsern kann ich nicht mehr aufstehen. Die Hitze hätte ihre Wirkung getan. Und einen Bruder, der nicht mehr aufstehen kann, wollte ich meinen Schwestern nicht antun. Alle blickten mich an, gespannt darauf, was der Bruder wohl bevorzugen würde. Es wurde Cognac vorgeschlagen. Das passiert später des öfteren, die meisten in Zentralasien denken wohl, im Westen trinken die Leute Cognac. Ich trinke keinen Alkohol! Verblüffung. Das hatte niemand erwartet. Das geht nicht, Du musst, hier wird anders gefeiert, das kannst Du nicht ablehnen.
Nach einigem Hin- und Her gab ich nach. Ich ließ mir einen Finger breit Rotwein in ein Wasserglas gießen und füllte den Rest mit Mineralwasser auf. Alle waren zufrieden. So überstand ich alle Feiern, was immer dort passierte. "Do konza!"-“Bis zum Ende!“ - Für mich ohne Schwierigkeiten. Bald war auch der Rotwein nicht mehr nötig, es ging für mich ganz ohne Alkohol.
Es war nicht so, dass ich keinen Alkohol trank und dass mir manches nicht schmeckte, ich verzichtete aus reiner Überlegung und Rücksichtnahme auf die mir vielleicht unbekannten Folgen. Wenn ich heute darüber nachdenke, war das eine glückliche Entscheidung, die mehr und mehr in mein normales Leben Einzug hielt.
Es wurden viele Toaste gesprochen. Es war sozusagen die erste offizielle Familienfeier. Teilnehmer gingen, andere kamen. Allen wurde ich vorgestellt als der so lange vermisste älteste Bruder, der nun endlich erschienen war. Jeder gab sich Mühe mit mir, wollte ein persönliches Wort mit mir sprechen, mich umarmen, mir auf die Schulter klopfen, ins Gesicht sehen. Unsere Geschichte wurde mehrfach hin- und hergedreht – jetzt war Realität, was keiner mehr geglaubt hatte. Wie auch, war doch viel Zeit vergangen. 50 Jahre, das Schicksal führte uns mit einer besonderen Wendung fort.
Diese Folgerungen: Der Vater verstorben, ich als ältester Bruder – jetzt war ich sozusagen Familienoberhaupt und, das ahnte ich natürlich nicht, wurden damit Erwartungen an mich geweckt, von denen ich nichts wusste. Darauf wird zurückzukommen sein. Der Grund ist einfach, ich konnte sie nicht alle erfüllen.
Die Frauen waren in der Überzahl, wie auch anders. Neun Schwestern, die Kinder dazu, sogar Enkelkinder waren dabei. Ich sah sie alle an und mein Herz wurde weit. Ich war erschüttert und glücklich.
Unsere Tafel wurde aufgehoben, der Älteste sprach ein Dankgebet. Alle wurden darin einbezogen, natürlich der Vater, unsere beiden Mütter.
Es ist ein Wort zur Verständigung notwendig. Mein Russisch war schlecht. Vier Mal hatte ich die Sowjetunion besucht, das erste Mal Ende der 60-er Jahre Moskau und Leningrad. Da war die Schule noch nicht lange her und ich bediente mich der Schulvokabeln. Die nächsten Male fanden Mitte der 80-er Jahre statt. Da hatte ich meine damalige Lebensgefährtin dabei. Sie hatte zunächst Russisch und Französisch studiert, einige Zeit als Dolmetscherin gearbeitet. Sie wollte nicht immer Übersetzerin bleiben, weshalb sie zusätzlich Volkswirtschaft studierte. Mit ihr waren die Besuche sehr einfach. Sie sprach sehr gut Russisch, bei einem Schnellsprechwettbewerb mit Moskauerinnen hätte sie gut abgeschnitten, was etwas heißen will. Also redete sie mit den Gesprächspartnern, antwortete ihnen, übersetzte gleichzeitig für mich. Das hatte eine gewisse Tragik für die kommenden Ereignisse. Wenn ich einmal selbst etwas formulieren wollte, war das Gespräch schon drei Themen weiter, so dass ich eigene Sprechversuche einfach sein ließ.
Mit den nunmehr rudimentären Kenntnissen trat ich diesen Besuch an. Als ich am dritten Tag aufwachte, waren alle Vokabeln aus meinem Gedächtnis verschwunden. Ich wollte etwas sagen – nichts. Mir fiel einfach nicht mehr ein, welches Wort ich verwenden soll.
Vorher hatte ich schon bemerkt, dass ich Wörter, die ich sicher zu glauben wusste, verwechselte, selbstverständlich die falschen Fälle und Wendungen benutzte, aber jetzt, jetzt war alles weg. Gehirn leer, ohne Wörter. Die Anderen bemerkten das und versuchten mir auf alle erdenkliche Arten zu helfen. Das hatte komische Züge. Sie schlugen bei meiner Stotterei viele andere Worte vor, die ich natürlich ebenso nicht verstand wie die notwendigen.
Es dauerte ein paar Tage, ich wurde sicherer. Wenn ich begann, eine Vokabel im Wörterbuch zu suchen, merkte ich sie mir und verwendete sie entsprechend.
Die Familie sorgte sich rührend um mich. Immer war jemand bei mir, nur nachts zum Schlafen war ich allein.
Wir fuhren in die Berge nach Medeo, Anuar und einige Kinder. Wir stiegen die Treppe zur Passstraße hoch. Sie beginnt etwas oberhalb des Eisstadions.
Es war unglaublich warm, die Höhe beträgt an dieser Stelle fast 2000 Meter. Diese Treppe lag steil vor uns. Das war ich nicht gewöhnt, Hitze, pralle Sonne, diese Höhe. Nach etwas mehr als der Hälfte wollte ich aufgeben. Anuar ging auf die Straße, die die Treppe mehrfach in Windungen kreuzt und hielt einen Mann mit einem Pferd an. Ich konnte aufsteigen. Vom Rücken des Pferdes sah die Sache schon ganz anders aus. Ich genoss den Ritt. Oben angekommen hatten wir einen wunderbaren Ausblick. Obwohl die Straße damals gesperrt war, fuhren einige Autos den Berg hinauf. Es entstiegen junge Leute, die sich für Fotos aufstellten.
Wir blickten lange ins Tal. Hinter uns lag das Hochgebirge. Ein schöner Fleck Erde ist hier – so fühlte ich.
Hinunter ging ich mit den Anderen. Eine kleine Nichte, Jasminka, wollte die letzten Stufen nicht mehr selbst gehen, Anuar nahm sie auf die Schulter und trug sie hinab. Die Straße nach Medeo zieht sich serpentinenartig ins Gebirge. Neben ihr fließt ein Gewässer, steinig, sprudelnd. Die Abfahrt war eine Erleichterung, ich hatte eine Strapaze hinter mir.
In einer Kurve hielten wir, stiegen aus. Über ein Rohr floss warmes Wasser. Wir zogen uns aus und ließen uns davon berieseln. Es soll gesund sein.
Wieder ein Verwandtenbesuch, alle wollten mich bei sich zu Hause als Gast haben. In diesen Tagen verschwammen diese Feiern. Immer die enge Verwandtschaft, Schwestern und Anhang, ebenso ständig neue Gesichter, alle herzlich, neugierig, offen, erwartungsvoll.
Museen, ich erinnere mich an ein Foto, welches wir machten. Eigentlich war fotografieren verboten, doch baten wir einmal um die Möglichkeit ein Foto zu machen von mir und dem Goldenen Mann. Das ist ein junger Mann, der mit goldener Kleidung in einer Grabstätte gefunden wurde. Mir wurde erzählt, dass dieser Goldene Mann eines Tages wieder lebendig wird, um das Volk aus einer schwierigen Lage herauszuführen.
Das Musikinstrumentenmuseum – eine Stätte der asiatischen Vergangenheit. Während ich in europäischen Museen die Ausstellung in meine zeitlichen Vorstellungen einordnen kann, liegen hier andere Maßstäbe vor. Ich musste genauer hinsehen, die Schilder und Erklärungen mehr recht als schlecht übersetzen. Aber ich bekam eine Vorstellung von dieser Musik. Sie ist so anders als unsere europäische. Die Völker hier waren Nomaden, was in den Rhythmen zum Ausdruck kommt. Hier werden die Tempi durch die Wanderungen bestimmt. Langsame, an den gemächlichen Gang der Kamele erinnernd bis hin zum Wirbel, der bei scharfem Ritt zu vernehmen ist. Diese Taktung nach Drittel, Dreiviertel usw. gab es in dieser Form nicht. Diese Musik versteht man sofort. Ein Museumsangestellter führte uns verschiedene Instrumente vor, er beherrschte sie hervorragend und trug so zu einem außerordentlichen Erlebnis bei. Diese Musik eröffnete mir auf ganz besondere Weise diese Welt, die Welt meiner Verwandten, meines Vaters.
Almaty liegt an einem Hang zum Hochgebirge. Im Hintergrund sind weiße Berge zu sehen. Hält man sich in den höheren Regionen der Stadt auf, ist die Luft angenehmer. Abends beginnt die Inversion, kalte Luft strömt vom Hang herab und bringt Kühlung. Je mehr man sich der Ebene nähert, desto stickiger wird die Luft.
Die Zeit verflog, Abreise nach Kysylorda.
Das Flugzeug war eine alte Antonov mit oben liegenden Tragflächen und einem Motor an jeder Seite. Beim ersten Anblick beruhigte ich mich mit der Überlegung, dass viele Passagiere hier einstiegen, eine Besatzung mit Kapitän, Pilot und Stewardessen alles keine Selbstmörder sind und wir wohl sicher ankommen werden.
Von Almaty fliegt man zuerst an diesem Gebirgshang entlang, nach einer halben Stunde entfernten wir uns davon. Ich blickte auf die Landschaft. Manchmal waren ein paar Häuser zu sehen, ansonsten viel Sand, der in der Sonne flimmerte, Manchmal Gesträuch. Anflug auf Kysylorda. Der Fluss Syr Darja schlängelte sich unter uns, hatte sich verästelt. Der Flugplatz liegt hinter dem Fluss etwas außerhalb der Stadt.
Viele neue Gesichter, deutsche Stimmen. Hubert, der Chef von Mira, war mit einem Kleinbus gekommen, mich abzuholen. Selbstverständlich waren viele Verwandte gekommen, alle umarmten mich, fassten mich an, so als würden sie prüfen wollen, dass ich kein Geist, sondern ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Sohn Amentais, wahrhaftig vor ihnen stehe.
Später ging Hubert nach Almaty und lehrte an der Universität. Ich erinnere mich gern an ihn.
Wir fuhren in die Wohnung, in der auch der Vater noch gelebt hatte. Unterwegs sog ich die Landschaft ein. Nach Verlassen des Flughafens zog sich die Straße durch die Steppe hin, ab und zu ein Strauch, ein paar Kamele, der Fluss. Die Stadt kam näher.
Shugla, ein Betonviertel mit gleichartigen Wohnblöcken. Wir stiegen die Treppe hoch. Vaters Wohnung, viele Leute. Wieder Begrüßungen, Umarmungen, Küsse, Vorstellungen, hinsetzen und essen und sprechen, fragen, antworten. Und die Kinder – ich sah sie und nahm sie sofort in ein Herz auf. Sie strahlten mich ganz besonders an, jedenfalls empfand ich es so.
Ich bekam ein Zimmer für mich. In der Wohnung war ein ständiges Kommen und Gehen. Ich wurde vielen Leuten vorgestellt. Das Problem hatte ich mehrfach in meinem Leben. Wenn man als Neuer in eine fest gefügte Gemeinschaft mit vielen Leuten kommt, dann wissen die, aha, das ist der Neue. Sie müssen sich nur ein Gesicht und einen Namen merken. Der Neue aber, der muss sich viele Gesichter und die vielen dazugehörigen Namen merken. Das dauert seine Zeit. So auch hier.
Die Wohnung hatte vier Zimmer, es lebten vielleicht 10 oder mehr Verwandte, Schwestern und deren Kinder darin. In der Küche wurde ständig gearbeitet. Nachts fiel manchmal der elektrische Strom aus, Wasser gab es häufiger nicht.
Eines ist mir sofort aufgefallen, die Menschen hier haben ein engeres Verhältnis zum Islam. Ich konnte es damals nicht abschätzen, wie eng es ist, aber es war auffällig. Da diese islamische Prägung ernsthaft praktiziert wurde, habe mich darin eingefügt.
Der Aul. Die Fahrt ging durch die Steppe. Ich sog gierig die Umgebung ein, sah die Trockenheit, ein paar muselmanische Gräber an der Straße.
Auf dem Hof von Almachan wieder Begrüßung, etwas essen, ausruhen, Fahrt zum Grab des Vaters. Nun fuhren wir nicht mehr auf einer Straße, sondern auf einem Weg quer durch die Steppe.
Wir stiegen aus. Mehrere muslimische Grabstellen standen inmitten der Steppe. Eins hatte der Vater für Anipa gebaut. Es bestand aus einer Mauer, die ein Viereck bildete. Nun lag er neben seiner Frau. Zuerst knieten wir nieder, es wurden Koranverse gesprochen, danach Bittgebete.
Wir legten Blumen nieder. Die Frauen trugen Kopftücher. Es wurden mir die Grabstätten der anderen Familienmitglieder gezeigt. Zum Schluss versammelten sich alle an den Autos , um zurück zu fahren.

Ich trat etwas weiter zurück und blickte noch einmal über die Gräber.
Nach Westen waren es ungefähr 4000 Kilometer bis Berlin und Dippoldiswalde, ich versuchte diese Entfernung gefühlsmäßig zu erfassen.
Ich dachte daran, dass ich meinen Vater nicht mehr kennen gelernt hatte. Meine Mutter war zwei Mal verheiratet, ihre beiden Männer haben sich um mich bemüht, ich konnte nicht klagen, aber manchmal im Leben habe ich mir jemanden gewünscht, mit dem mich ein richtig inniges Verhältnis verbunden hätte, den Vater, ebenso den uneigennützigen Ratgeber.
Soweit ich zurückdenken konnte, habe ich meine Entscheidungen allein gefällt. Manchmal habe ich einen Freund oder einen Experten befragt, aber letzten Endes war ich auf mich allein gestellt.
Verschiedenes konnte ich mit niemanden besprechen, da musste ich meine eigenen Erfahrungen machen. Das war manchmal mit Fehlern verbunden, woher sollte ich das auch wissen.
Nun stand ich also an seinem Grab, wenigstens das hatte ich noch geschafft. Alles, was ich über ihn gehört hatte, war, dass er ein aufrichtiger Mensch war, zu den Kindern gütig. Alle sprachen nur Gutes über ihn und ich glaubte heraus zu hören, dass da kein falscher Ton war, sondern alle, die ihn kannten und nun über ihn sprachen, ihm sehr verbunden waren.
Das hat mich mit Glück erfüllt. Ich versprach ihm, wieder zu kommen.
Ich ging zu den anderen, wir stiegen in die Autos und fuhren zurück auf den Aul.
Es gab, was sonst zu einer solchen Gelegenheit, Beschparmak. Als das Fleisch herein getragen und zerkleinert war, bekam ich als Ehrengast die beiden Augen des Geschöpfs gereicht. Ich blickte sie an und sie blickten mich an. Alija, meine älteste Schwester, saß neben mir und sah das Schauspiel.
Sie beugte sich zu mir und fragte leise: Möchtest Du die essen? Nein.
Sie nahm die beiden Augen mit einer Hand von meinem Teller und diese Sache war bereinigt.
Beschparmak schmeckt köstlich. Die Älteren nahmen sich das Essen mit der Hand aus der Schüssel, so wie es sich gehört. Die anderen, so auch ich, nahmen zuerst von der Schüssel auf den Teller und aßen mit einer Gabel oder einem Löffel. Natürlich standen Gemüse, Getränke, später Obst und Süßigkeiten auf dem Tisch.
Ebenso natürlich erhielt ich mein Mineralwasser.
Nach dem Essen saßen wir unter den Bäumen einer kleinen Obstplantage. Später gingen wir spazieren. Was heißt das schon. Ich bekam ein Pferd zum Reiten. Es war ein großes Pferd, sie bezeichneten es als Engländer. Ein Cousin führte diesen Engländer. Ich sah, wie meine kleine Schwester auf ein kleines Pferd ohne Sattel sprang und sofort los galoppierte. Es war das Bild einer Amazone.
Ich sah den Aul. Seine Häuser, Höfe, Wege, Sträucher, Bäume. Die Sonne brannte unbarmherzig herab. Und ich dachte an die Hektik in meinem Leben. Hier lief die Zeit langsamer, die Menschen hatten andere Lebensrhythmen.
Wenn man vorher das einzige Kind der Mutter war und immer so gelebt hat, ist die Großfamilie eine andere Welt. Jetzt kam noch hinzu, dass alles auf diese zentralasiatische Weise lebte. Ich gewöhnte mich schnell daran, es fiel mir nicht schwer. Eine Zeit lang versuchte ich, diesen Rhythmus und dieses Lebensgefühl in mir aufzunehmen. Es gelang mir im Großen und Ganzen recht gut. Nicht immer, aber es kam mir vieles entgegen. Alles war neu, der Wusch entstand, mit der Familie zu leben. Hier tat sich eine Welt für mich auf, Hoffnungen wuchsen, alles sollte zu einem guten Ende geführt werden.
Der Lebensstil in Berlin trennt Welten von dem in Kysylorda, geschweige denn von dem auf dem Aul.
Die Schwestern zeigten mir ihre Fotografien. Als sie mir die Orden des Vaters brachten, fragten sie mich, ob ich die haben möchte. Ja.
Ich nahm die Orden des Vaters mit nach Hause. Hiermit begann die erste Annäherung an den Apparat, den Staatsapparat. Das entwickelte sich zu einer sehr menschlich rührenden Episode. Mein Irrtum bestand später darin zu glauben, dass das so allgemeingültig sei.
Jemand befand, dass es eine Urkunde von einem Notar dafür zur Ausführung für den Zoll geben muss. Der Notar händigte mir ein Papier mit Stempel und Siegel aus. Kosten – 40 Dollar.
Na wenigstens hatten wir nun das Gefühl, dass es an der Grenze keine Probleme damit geben dürfte.
Natürlich lag die Frage nahe, wie der Vater die immer weiter wachsende Reihe der Töchter betrachtete. Man stelle sich einmal vor:
Das erste Kind kommt, ein Mädchen, das ist normal.
Das nächste Kind kommt, wieder ein Mädchen, naja.
Das nächste Kind kommt, wieder ein Mädchen, hmm.
Und so weiter ...
Die Schwestern erzählten mir, dass er begann, wenn er nach Hause kam und das nächste
Kind war da, zu fragen, was es dieses Mal sei. Wieder ein Mädchen.
"Es soll mir recht sein." Er ging hinein, nahm das Neugeborene und begrüßte es innig und nahm es in sein Herz auf.
Seine Nachbarn und Freunde neckten ihn natürlich damit, ob er denn keinen Sohn machen kann. Und sie gaben ihm scherzhaft Ratschläge, wie das funktionieren soll.
Irgendwann bei der 6. oder 7. Tochter verlor er ein wenig die Haltung und sagte, dass er einen Sohn in Deutschland hat. Da lachten sie alle, weil er niemals vorher darüber geredet hatte und es deshalb natürlich niemand glaubte.
Nun, im Nachhinein hat ihn mein Erscheinen rehabilitiert.
Immer wenn ich in Kysylorda war, was ich bei jeder, auch den folgenden Reisen besuchte, traf ich Leute, die große Freude zum Ausdruck brachten, dass sie einem solchen Menschen wie mir begegnen. Ich erfuhr viel Zustimmung, Freude, Herzlichkeit.
Als ich beim ersten Male aus Kysylorda wieder abflog, stand am Abfertigungsschalter des Flughafens ein junger Polizist. Er sah meinen deutschen Pass und sagte: Koffer öffnen!
Ich war mit meinen Schwestern, den Nichten und Neffen, kurz gesagt, der ganzen großen Familie dort. Meine Schwestern redeten auf ihn ein: Das ist ein Koscha, den braucht man nicht so zu behandeln ...
Er fragte mit ernstem Gesicht: Ein Koscha mit einem deutschen Pass? - Ja, das stimmt, er ist unser Bruder aus Deutschland, er ist das erste Mal hier!
Er schloss den Koffer wieder und wir alle gingen auf das Flugfeld. Die anderen Passagiere, Amerikaner, Kanadier, Zentralasiaten blickten auf uns. Was ist hier los? Alle mussten ihre Begleiter an der Schranke zurücklassen und hier kommt einer mit einer ganzen Entourage zum Flugzeug auf das Feld.
Die Folge war, jedes Jahr, wenn ich aus Kysylorda weg fliege, steht der gleiche Polizist am Schalter. Meine Schwestern geben ihm meinen Pass. Ich sitze noch mit der Verabschiedungsdelegation zusammen, bis es Zeit wird, in den Abflugraum zu gehen. Ich begrüße den jungen Polizisten und wir tauschen ein paar Worte aus.
Es sind diese Erlebnisse, die mich fühlen lassen, dass ich langsam in diese Gemeinschaft hineingewachsen bin. Ich bin herzlich aufgenommen.
Diese erste Reise zur Familie versetzte mich in einen Ausnahmezustand. Die vielen neuen Eindrücke waren das eine, die Annäherung an die Familie, an ihre Lebensweise das andere.
Es hatte nichts exotisches für mich. Ich dachte, so lebte der Vater, wenn ich mit ihm hierher gekommen wäre, würde ich auch so leben. Das heißt, es kam erst gar keine große Distanz dazu auf. Es war nur gewöhnungsbedürftig für mich, aber nicht fremd. Der Vater lebte so, warum soll ich mich dem nicht nähern?
Dieses Land ist das Land meines Vaters, meines Vaters Land, mein Vaterland. Das waren meine Gedanken.
Bei der Abreise war klar, die Familie hatte zusammen gefunden und nichts soll sie jemals auseinander bringen.
Jeder weiß natürlich, das Familienleben ist nichts statisches, da gibt es Entwicklungen. Manche mögen sich etwas mehr, manche etwas weniger. Es unterliegt Schwankungen, letzten Endes hält das gemeinsame Blut alles beieinander. Das ist überall auf der Welt so.
Bei der Ausreise wollte der Zollbeamte meine Zollerklärungen. Ich hatte eine ausgefüllt, die von der Einreise hatte ich nicht.
Mir fielen die kleinen weißen Zettel ein, die die Stewardessen beim Anflug auf Almaty verteilt hatten. Das nutzte mir jetzt wenig.
Der Zöllner griff mit sehr ernstem Gesicht zielgerichtet in den Koffer und fragte, die Orden ergreifend, was das sei. Ich antwortete ruhig: Mein Vater war aus Kysylorda, ich bin das erste Mal hier und habe seine Familie besucht. Ich war an seinem Grab. Das sind seine Orden.
Der Zöllner stand auf, packte die Orden wieder in den Koffer, sah mir in die Augen, drückte mir lange und fest die Hand. Er machte ein Zeichen, dass ich passieren kann.
Im Flugzeug beschloss ich, in Berlin nach Landsleuten zu suchen.
Bevor ich das erste Mal nach Zentralasien flog, hatte ich einen Prozesstermin. Ich war wegen Beleidigung angezeigt worden, hatte eine umfangreiche Erläuterung zum Geschehen an das Gericht geschrieben und um Terminaufschub gebeten. Der wurde gewährt. Nun zurückgekehrt stand dieser Termin zunächst für mich im Mittelpunkt. Die Richterin erklärte mir, dass sie mich völlig versteht, die Rechtslage aber so sei, dass, wenn sie das Verfahren eröffnen würde, sie mich verurteilen müsse. Sie wolle das nicht. Wenn ich einverstanden sei, würde ich eine kleine Geldstrafe erhalten und die Sache sei erledigt. Was sollte ich tun? Ich war einverstanden.
Von dieser Last befreit rückte die Familie und das zentralasiatische Land wieder in den Vordergrund. Als erstes natürlich stand das Internet zur Verfügung. Eine Studentin aus München hatte sich mit dem Land befasst und eine Beschreibung des Landes, der Geografie, des Klimas und der gesellschaftlichen Strukturen ins Netz gestellt. Interessiert las ich diese Ausführungen. Etwas stutzig wurde ich, als sie schrieb, dass die dortige Gesellschaft niemanden aufnimmt. Man kann machen was man will, Teil dieser Gesellschaft wird man nicht, wenn man von außerhalb kommt. Nanu? Gerade hatte ich die Herzlichkeit der Menschen kennengelernt, wie sie mich als einen der Ihrigen behandelten und am liebsten ganz haben wollten - für mich ein Widerspruch. Aber woher sollte sie das wissen? Ich habe später des öfteren an diese Studentin gedacht. Ich lernte sie sogar kennen. Der Präsident des Landes hatte sie empfangen und sich mit ihr unterhalten.
Ich suchte weiter und fand einen Verein, der Deutschland und das zentralasiatische Land im Namen führt. Ich trat ihm bei und sog alle Informationen, die man bei den Veranstaltungen manchmal aus erster Hand erhielt, ein. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur – ein weites Spektrum öffnete sich mir.
Geprägt wurde der Verein durch einen Politiker einer Partei, die damals in der Opposition war und durch die Botschaft des Landes. Die meisten Mitglieder haben ein Interesse an diesem Land, seien sie wirtschaftlicher Art, seien sie anderwärtig ausgerichtet, zum Beispiel durch berufliche Beschäftigung. Einen Zweiten wie mich gab es nicht. Ab und an sahen Übersiedler vorbei, schließlich sind aus diesem Land fast eine Million Deutsche gekommen.
Anfangs berichtete ein deutscher Wirtschaftsprofessor, der an einem ökonomisch ausgerichteten Forschungsinstitut in Almaty eine hohe beratende Funktion innehatte, regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung. Durch große Rohstoffvorkommen, Öl, Gas und viele andere Bodenschätze ging es rasant vorwärts. Nach und nach wurde die Struktur der Bürokratie durch andere Leute besetzt und wesentlich geändert. Da ich nach dem Ende des Sozialismus in einigen Konversionsländern Einsätze hatte, sah ich, wie sich bestimmte Entwicklungen im Osten Europas und in Zentralasien ähnelten und selbst die Fehler wiederholt wurden.
Bei diesen Veranstaltungen waren Mitarbeiter der Botschaft zugegen. So begegnete ich ihnen das erste Mal.
Im Mai 2000 fand eine größere Veranstaltung zu KMU's (gängige Abkürzung für „Kleinere und mittlere Betriebe“) statt. Eine Delegation aus Almaty war angereist. In einer Pause wurde ich mit dem damaligen Chef des Institutes, einem Almatinsker Wirtschaftsprofessor, der aus Kysylorda stammte, bekannt gemacht. Er fragte mich nach meinen Wurzeln. Dazu muss man wissen, dass das Land als Clangesellschaft lebt. Die Zuordnung zum Clan bestimmt deine Stellung.
Ich verstand diese Frage nicht richtig, ebenso wenig ihre Bedeutung, weshalb ich mit dem Namen meines Vaters antwortete. Er kannte ihn nicht. Anschließend unterhielt ich mich mit drei Frauen der Delegation.
Wir verabredeten, die Mittagspause zusammen zu verbringen. Es ist kein Geheimnis, im Kreise von Frauen fühle ich mich wohl, parliere mit ihnen und lasse meinen ganzen Charme los. Da ich ein fröhlicher Mensch bin, fallen mir meistens die entsprechenden Geschichten, Episoden und Bonmots ein. Weil ich mir ungeschickt eine Tasse mit Kaffee über das Hemd goss, fuhr ich nach dem Essen nach Hause zum Wechseln. Wieder zurückgekehrt, lud ich die Drei ins Auto, um gemeinsam mit ihnen zu einem Empfang in die Botschaft zu fahren.
Der Botschafter war ein älterer Herr, der nach hohen Posten in Almaty diese Stelle bekommen hatte. Er machte einen gütigen Eindruck. Ich traf den Professor wieder, der mit einem Abgeordneten aus seiner Heimat auf der Freitreppe stand. Ich ging zu beiden hin und sagte: Ich weiß jetzt, was sie fragen wollten. Ich bin ein Koscha!
Beide blickten mich ungläubig an, der Abgeordnete meinte: Ein Koscha! Und schüttelte den Kopf.
Natürlich hatte ich mich mit einer der drei Frauen etwas enger verabredet. Im Sommer wollte ich ja wieder nach Almaty fliegen. Wir verabredeten, miteinander zu mailen und uns zu treffen. Während des Empfangs widmete sie mir allerdings nur wenig Zeit.
Im August flog ich wieder nach Almaty. Meine neue Bekannte hatte aber erst am letzten Abend vor meinem Rückflug nach Berlin Zeit für mich.

Almaty – Familienbesuche, Ausflüge in die Stadt, nach Kaptschagai, in die Berge. Abends gingen wir im Atakentpark essen und tanzen.
Meine Schwestern waren rührend um mich besorgt, organisierten meine Zeit. Ich war glücklich.
Wieder Abflug nach Kysylorda. Familienfeiern, Verwandtenbesuche, abends in den Park.
Es gab eine Besonderheit, die erste Hochzeitsfeier für mich. Die Straße war mit Teppichen ausgelegt, niedrige Tische aufgestellt, der ganze Häuserblock traf sich. Die Musiker spielten auf der Dombra. Wer das noch nicht gesehen hat: Ein Sänger bekommt einen Zettel mit den Namen anwesender Gäste, er singt aus dem Stegreif einige Verse zu diesem Gast, die Dombra klingt, der oder die Besungenen treten in den Kreis, sprechen ihre Glückwünsche für das junge Paar, legen Geld in ein Gefäß, tanzen ein wenig. Das wiederholt sich, bis alle besungen worden sind. Die Braut steht mit ihrem Zukünftigen mit einem Schleier bedeckt. Später sah ich noch andere Aufstellungen, die Brautleute haben ihre Freundinnen und Freunde neben sich. Sie schweigen bis zum Schluss.
Die Eltern sprechen ihre Wünsche für eine gute Zukunft aus. Es werden Koranverse zitiert, Bitt- und Dankesgebete gesprochen.
Endlich wird der Schleier gehoben, sie geben sich das Ja-Wort. Anschließend gehen sie mit Kuchen in die Runde und geben den Gästen davon eigenhändig zu essen. Es wird bis in die Nacht hinein gefeiert, gegessen, getrunken, getanzt.
Ich war begeistert.
Wieder in Almaty. Warten auf den Anruf und das Treffen. Wir saßen in einem Restaurant, welches an der Straße nach Medeo unmittelbar am kleinen Flüsschen liegt. Wir sprachen miteinander, aßen, eine neue Zukunft tat sich auf. Im Grunde wusste ich nicht viel von ihr. Ich sah nur, dass sie offensichtlich aus einer anderen Schicht als meine Schwestern, also auch ich, stammt und entsprechend redete und handelte. In der Nach kehrte ich nach Berlin zurück.
Zu Weihnachten besuchte sie mich. Sie wollte, dass ich einen Brief an ihre Mutter schreibe, in dem ich um ihre Hand anhielt. Wir schrieben ihn, sie nahm ihn mit. Wir kauften Ringe und verlobten uns. Als ich sie zum Flughafen zum Heimflug brachte, wurde sie nach der Passabfertigung noch einmal herausgerufen. Die Zöllner hatten in ihrem Koffer polnische Wunderkerzen gefunden. Das war zweifach verboten, polnische, also ohne Zulassung für Deutschland, Wunderkerzen und explosive Stoffe im Koffer. Ich nahm dem Zöllner die Dinger aus der Hand und sagte, dass ich sie entsorgen werde. Die beiden Zöllner sahen sich an und verabschiedeten sich mit einer Bemerkung, die ungefähr so klang, dass sie in diesem Falle mir einmal vertrauen und die Sache auf sich beruhen lassen wollen. Schönes neues Jahr!
Über meine Braut, wie es weiterging mit uns beiden und warum es letzten Endes scheiterte, möchte ich nichts weiter schreiben. Ich habe sie nicht verstanden, es gab Missverständnisse, ich fand keinen Weg zu ihr und ihrem Inneren. Trotzdem denke ich mit ein wenig Wehmut an sie zurück. Ich bin von mir enttäuscht, dass ich in diesem Falle versagt habe. Ich fand den Schlüssel nicht.
Nur eine Episode möchte ich hier erzählen, weil sie typisch für Zentralasien ist.
Im darauf folgendem Sommer lud sie mich zu einer Reise ein. Ziel – der Issyk Kul, jener malerische See in Kirgistan auf 1.600 Meter Höhe, vom Hochgebirge umgeben, kaum Tourismus, aber eine unglaublich schöne Natur.
Wir gingen zu einem Reisebüro in Almaty, welches sie vorgeschlagen hatte. Dort zeigte uns der Chef Prospekte und Bilder von Ferienheimen und er empfahl uns eins. Der Preis für ein paar Tage betrug 400 Dollar. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass ich ein Visum für eine einmalige Einreise in das Land habe. Wenn ich nun nach Kirgistan fuhr, würde ich ein zweites Mal einreisen müssen. Das ist kein Problem, er wird für alles sorgen. Ich überließ ihm meinen Pass. Von ihm zurück erhielt ich ein Einreisevisum für Kirgistan, mehr nicht. Die Reise sollte abends in Almaty beginnen. Meine Verlobte kam etwas eher und sagte mir, dass ihr Bruder kommen und ihren Koffer bringen wird. Wir gingen gemeinsam auf die Kreuzung Furmanova – Hadschi-Mukano und warteten ein wenig. Es erschien eine Mercedes S-Klasse, sie hielt neben uns, der Fahrer, ein junger Mann, stieg aus und begrüßte seine Schwester herzlich mit Umarmung. Mich würdigte er keinen Blickes. Ich war Luft für ihn. Er öffnete die Heckklappe des Wagens, hob einen Koffer heraus. Danach verabschiedete er sich wieder herzlich von seiner Schwester und fuhr davon. Oje dachte ich, wie armselig das war.
Später kam ein alter VW Passat. Er zeigte schon Rost und machte einen wenig vertrauensvollen Eindruck. Aber was die Gefährte in Zentralasien anbelangt, hatte ich schon in Almaty und Kysylorda einiges gesehen und habe sogar in einigem gesessen, so dass mich das nicht mehr sonderlich berührte. Der Chef kam selbst mit. Das wunderte mich ein wenig. Wir holten später noch eine Frau ab und die Fahrt zum Issyk kul begann. Es wurde rasch dunkel. Ein Gespräch flackerte manchmal auf. Wir näherten uns der Grenze. Der Grenzsoldat ließ sich die Pässe zeigen, meinen nahm er mit. Nach einer Weile kam er zurück und sagte, dass ich nur eine einmalige Einreise ins Land habe und wenn ich jetzt ausreise, könne ich nicht wieder einreisen. Ich zeigte auf den Direktor des Reisebüros. Der schwieg. Der Soldat verschwand, erschien wieder. Es kostet 100 DM, so würde es gehen. Ich griff in meine Tasche, zog das Portemonnaie und zeigte es ihm. Ich habe aber nur 40 DM. Der Soldat verschwand, kam wieder und sagte, dass alles in Ordnung sei, 40 DM reichen. Ich gab sie ihm. Er wollte wissen, wann wir wieder zurückkehren, damit er alles organisieren kann.
Auf der kirgisischen Seite fuhren wir im Schritt durch die Grenzanlagen und wurden nicht angehalten. Die Fahrt zog sich hin. Das Licht am Auto wurde immer düsterer, ich ahnte, es würde eine Reparatur geben mitten im kirgisischen Gebirge. Und richtig, bald hielten wir. Der Fahrer und der Direktor stiegen aus, fummelten im Dunkeln unter der Motorhaube etwas herum. Schließlich konnten wir weiterfahren.
Morgens gegen 7 Uhr kamen wir am Hotel an. Alles war verschlossen. Wir gingen ein wenig spazieren und warteten auf das Personal. Zwei Stunden später erschienen die ersten Bediensteten. Etwas später der Leiter des Erholungskomplexes. Der wusste natürlich von nichts. Keine Reservierung, keine Ankündigung, nichts. Mir wurde klar, warum der Direktor des Reisebüros mitgekommen war.
Die Verhandlungen begannen. Der Hoteldirektor sagte uns eine Summe, die für ein paar Tage viel zu hoch lagen. Der Direktor des Reisebüros schob uns die bezahlten 400 Dollar über den Tisch und meinte, jetzt sollen wir alles selbst aushandeln.
Wir sollten uns einmal die Suite des Präsidenten ansehen, die wäre es doch wert. Wir gingen zu diesem Haus und sahen uns die Zimmer an. Wir wollten aber keinen so hohen Preis bezahlen. Vor dem Zimmer des Direktors warteten wir eine Weile. Ich sagte einer Angestellten, die uns begleitete, dass ich aus Berlin bin und darüber erstaunt, dass wir nach einer Reise vom Abend vorher bis heute früh, danach warten, Verhandlung und nun wieder warten, hungrig, durstig verschwitzt, nun einfach so warten sollten. In Zentralasien habe ich eine solche Behandlung das erste Mal erlebt. Sie sah mich an, ging kurz weg, kam wieder und bat uns, ihr zu folgen. Wir konnten uns waschen, bekamen etwas zu essen und Kaffee, danach war der Direktor zu sprechen. Alles vergebens, er bestand auf dem hohen Preis, wir fuhren weiter.
Schließlich gelangten wir in einen Erholungsort. Wir steuerten ein großes Hotel an. Auch hier wurde mehr verlangt, als meine Verlobte zu zahlen bereit war. Die Angestellte versicherte uns, wir können für den Preis bleiben, wie er uns vorschwebte. Danach mussten wir die Pässe abgeben.
Der See, der Park, die Luft, alles war bezaubernd. Wir badeten, wobei ich den Eindruck hatte, der einzige Schwimmer zu sein. Abends saßen wir auf dem Balkon mit Blick auf den See. Als ich einmal vom See zurück ins Hotel kam, saßen im Park auf der Bank zwei Männer und aßen und tranken. Sie luden mich zu einem Wodka ein. Ich setzte mich zu ihnen, Wodka trank ich nicht, aß von ihren Gurken und vom Brot. Wir unterhielten uns. Beide hatte Deutschland schon dienstlich besucht und schwärmten davon. Zu reden haben die Leute in ganz Zentralasien immer etwas, besonders wenn sie einen Ausländer treffen. Und als ich meine Geschichte erzählt hatte, ich, der Koscha Bakpanbet, waren sie gerührt. Ich sah es wieder, das einfache Volk freut sich mit uns über ein solch außergewöhnliches Schicksal. Diese Erfahrung zieht sich durch die Geschichte und ich konnte sie immer wieder machen. Manche weinten, manche strahlten uns an – immer war Herzlichkeit und Mitgefühl zu spüren.
Zurück fuhren wir mit dem regulären Bus, der Direktor des Reisebüros wollte für Reibungslosigkeit sorgen. An der Rezeption wurde uns die Rechnung überreicht, natürlich stand der reguläre Preis darauf. An eine Verabredung erinnerte sich niemand, sie hatten unsere Pässe. Bezahlen – Pässe, nicht bezahlen – keine Pässe.
Der Busfahrer wusste Bescheid. Wir unterhielten uns, er fragte mich nach meinem Schicksal. Auch er war gerührt davon. Nun besprachen wir den Grenzübergang. Ich soll, wenn er mir ein Zeichen gibt, in die Bustoilette gehen und mich still verhalten, bis er mich wieder herausholt. Die anderen Busreisenden interessierte das nicht. Das Zeichen kam, ich verschwand. Der Bus hielt, Schritte polterten durch den Bus, schließlich fuhr er wieder los. Wieder Einreise, wieder Poltern, Abfahrt, geschafft. Wir waren wieder im Lande. In Almaty setzte er uns an einer günstigen Stelle ab, nicht ohne von uns noch vorher Geld zu verlangen. Wir gaben es ihm.
Mitte der 90-er Jahre hatte ich einen Aktienclub gegründet und ich besuchte bei jeder Reise in eine andere Stadt die Börse, wenn eine vorhanden war. So auch in Almaty.
Es war schwierig, überhaupt vorgelassen zu werden. Ich bestand darauf. Schließlich konnte ich eine Leiterin im Apparat sprechen. Ich wollte Informationen. Die konnte sie aber nicht geben. Ich sagte ihr, dass der Wertpapiermarkt eine Frage der Informationen und des Vertrauens sei. Ohne sie und ohne Transparenz kauft kein vernünftiger Mensch Papiere von Firmen. Sie verwies mich an die Londoner Börse. Naja, Papiere dieses Landes konnte man unter solchen Umständen nicht kaufen. Auch eine Erfahrung.
In Berlin fand nicht ein Jahr später eine Konferenz zum Tourismus ins Land statt. Dabei wurde der neue Botschafter vorgestellt, der sich ins Präsidium setzte. Zu meinem Erstaunen sah ich den Direktor des Reisebüros, mit dem wir diese Reise an den Issyk kul gemacht hatten, als Delegationsmitglied neben ihm sitzen. Er hielt auch noch einen Vortrag darüber, welche Reisen er organisiere und welche Vorteile es hat, sein Reisebüro zu benutzen. Ich sagte nichts dazu im offiziellen Teil. Aber am Ende der Veranstaltung fragte ich eine Funktionärin des Vereins, ob das Land seine Botschafter nicht vor solchen Scharlatanen schützen kann.
Naja, ein Jahr später gab es mit einem anderen Mitglied des Vereins noch einen Film mit diesem Reisebüro, der im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Da äußerte ich mich dazu mit der Bemerkung, dass es wohl noch 100 Jahre dauern wird mit der Entwicklung des Tourismus, wenn solche Experten dafür am Werk sind.
Ich lernte bei Veranstaltungen des Vereins einen Schriftsteller kennen, Didar Amentai. Er las im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Später saßen wir in einer Kneipe in Berlin-Wilmersdorf zusammen und unterhielten uns. Seine Dolmetscherin war eine Deutsche, die schlecht übersetzte. Ich spreche zwar selbst schlecht russisch, aber wenn jemand schlecht übersetzt, höre ich das.
Wir saßen lange, ich fragte ihn nach seinen Plänen. Er wollte nach Frankreich reisen, um sich mit Albert Camus zu beschäftigen. Ich fragte ihn, warum ein zentralasiatischer Schriftsteller sich ausgerechnet mit Albert Camus beschäftigen möchte. Das ist ungewöhnlich. Die Antwort war nicht überzeugend, er wollte es. Später erzählte ich meine Geschichte.
Meine Situation war nunmehr folgende – meine Mutter und ihr Mann lebten in Berlin, meine gesamte andere Verwandtschaft in Almaty und Kysylorda. Meine Braut in Almaty. Was lag näher, als wenigstens eine gewisse Zeit nach Almaty zu gehen und sich das Leben dort einrichten.
Also suchte ich eine Arbeit. Meine Voraussetzungen waren günstig, ich habe lange Zeit in Firmen Datenverarbeitung eingeführt und weiterentwickelt. Studiert hatte ich Betriebswirtschaft. Nach dem Ende der DDR hatte ich zeitweise in Osteuropa in Konversionsländern Firmen mit eingerichtet und EDV-seitig betreut.
Ich lernte die Verantwortliche für die Deutsche Wirtschaft in Almaty kennen. Ein deutscher Botschaftsrat, der sich gerade verabschiedete, meinte, ich solle dort unbedingt anfangen, ich solle es der Leiterin sagen, dass er es für richtig hält und wünscht. Ich hatte eine lange Unterhaltung mit ihm. Er gefiel mir. Er hatte einen Wanderplan für Almaty und Umgebung gemeinsam mit seiner Frau geschrieben. Schon das, was also darauf hinwies, dass sein Einsatz dort nicht nur Abarbeitung, sondern er Interesse für Land und Leute hatte, machte ihn mir sympathisch.
Das Gespräch fand auf dem Flughafen in Almaty statt, wir flogen mit unterschiedlichen Airlines nach Deutschland zurück.
Ich mailte Anfang der darauf folgenden Woche der Leiterin nach Almaty. Muss ich es extra hier hinschreiben? Nein – selbstverständlich erhielt ich keine Antwort. Das zieht sich über viele Jahre so hin. Anfragen, Anliegen stellen – keine Antwort. Sogar jetzt, wo im Land eine elektronische Verbindung mit der Regierung implantiert wurde, also Post und lange Laufzeiten von Briefen nicht mehr eintreten, kann man allen schreiben – erhält aber selbstverständlich ebenfalls keine Antwort. Technik des 21. Jahrhunderts kommt zum Einsatz – die Khane reagieren ihrer würdig – mit Nichtachtung, also 19. Jahrhundert.
Nun, manchmal gaben mir Bekannte, Verwandte, Freunde Hinweise auf eine Arbeitsmöglichkeit in Almaty. Alle Bewerbungen, alle Intentionen dieser Art blieben ohne Antwort. Langsam merkte ich, dass die Studentin, die diese Bemerkung im Internet über die Gesellschaft geschrieben hatte, klüger war als ich. Nach zwei bis drei Jahren hatte ich immer noch die Hoffnung, dass es einen Platz für mich im Lande geben würde. Endgültig begraben habe ich es etwas später. Bei einer Veranstaltung des Vereins schaute der oben erwähnte Botschaftsrat vorbei. Wir unterhielten uns. Er interessierte sich, wie seine Arbeitsergebnisse sich weiter entwickelt hatten. Schließlich kam er auf meine Situation zurück. Als ich ihm meine Erfahrungen nun erzählte, meinte er, ich solle einen Zuständigen in einer deutschen Organisation für Entwicklungshilfe in Frankfurt anrufen. Der vermittelt Experten in alle Welt.
Am nächsten Tag rief ich gleich an. Er wollte von mir wissen, was ich bin und kann. Als er feststellte, dass ich besser russisch sprach als er, kam spontan – In vier Wochen fahre ich dorthin. Wenn ich zurückkomme, haben sie eine Stelle.
Er kam zurück. Wieder rief ich ihn an. Kleinlaut gab er mir zu verstehen, dass niemand mehr als Berater gewünscht wird. Ich rief in Almaty an und fragte mich durch. Resultat? Natürlich werden Berater gesucht. Da war es klar – für mich gibt es keine Stelle, kein Leben im Lande meines Vaters.
Die Studentin hatte recht, niemand, absolut niemand wird aufgenommen. Nicht einmal ein Mensch mit einem Vater von dort, mit einer solchen Familiengeschichte. Die Khane waren noch konsequenter als die stalinistischen Funktionäre in der tiefsten Repressionsphase. Was war der russische Major dagegen für ein Mensch.
Die einfachen Menschen freuten und freuen sich bis heute mit uns über unser glückliches Zusammenfinden, den Khanen waren wir lästig. Ich dachte an Abai.

Jenen Schriftsteller aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert, der als großer nationaler Schreiber gilt, den alle im Munde führen. Seine Denkmäler stehen überall im Land. Er litt unter den Khanen, sein Vater war selbst ein unbarmherziger, gnadenloser Clanchef. Daran erinnerte ich mich jetzt.
Es war durch mich nicht zu beeinflussen. Ich fuhr jedes Jahr zur Familie. Unsere Erwartungen konnte ich nicht erfüllen. Die Besuche begannen sich zu ähneln. Almaty, Kysylorda, Almaty, nach Hause.
Vaters Wohnung in Kysylorda wurde verkauft, ich wohnte bei meiner ältesten Schwester Alija.
Mit ihr verbindet mich eine tiefe Zuneigung. Selbstverständlich bin ich auch jedes Jahr auf dem Aul. Almachan, unser Familienoberhaupt ist ein würdiger Mann.
In Almaty wohnte ich immer bei Rimma und Anuar. Das Haus in der Hadschi-Mukano mussten sie verkaufen und zogen in eine Wohnung etwas näher an der Stadt. Anuar ist sehr fleißig, weshalb er ein Grundstück suchte, um mit einem neuen Haus zu beginnen. Als das schließlich einigermaßen bewohnbar war, musste er es wieder verkaufen und sie zogen in den Microrayon Almagul. Rimma und er sind vom Bauboom in den letzten Jahren besonders betroffen gewesen.

Wenn ich bei ihnen war, machte ich meine eigenen Ausflüge in die Stadt.
Wie sollte es nun prinzipiell weitergehen? Ich wollte die Verbindung enger gestalten. Ebenfalls hatte ich den Wunsch nach einer Frau, also wollte ich eine aus Zentralasien.
Meiner Verlobten teilte ich mit, dass es so nicht weiter gehen kann und ich mir eine andere Frau suchen werde. Sie reagierte hektisch. Aber schließlich haben wir uns schon mehr als ein Jahr nicht mehr gesehen, sie unternahm nichts. Meine Klärungsversuche endeten in ihrem Schweigen. So wollte ich natürlich nicht leben.
Frauen aus Zentralasien. Ich traf mehrere, auch in Berlin, die mir gefielen, mit denen ich mir mehr vorstellen konnte. Aber die Umstände waren teilweise ungünstig, andererseits hatte ich erfahren, dass ich in der sogenannten besseren Gesellschaft nicht erwünscht bin und wieder nur Unglück bringe, wenn ich eine solche Liaison eingehe. Ich habe an dieser Stelle von der im Vorwort angekündigten Möglichkeit des Weglassens Gebrauch gemacht. Es gäbe viel dazu zu sagen.
Also habe ich keine Versuche in diese Richtung mehr unternommen. Ich dachte an den deutschen Botschaftsrat, mit dem ich mich auf dem Almatinsker Flughafen unterhalten hatte. Ich stellte ihm nämlich noch eine Frage, wie ich darauf gekommen bin, weiß ich nicht, sie drängte sich einfach auf. Sie lautete: Nutzen oder schaden mir meine neun Schwestern? Er blickte mich an und sagte: Sie schaden ihnen. Ich schluckte es herunter. Daran dachte ich mehrfach. Sie alle liebte ich, sie alle liebten mich – der Botschaftsrat hatte recht, das war mir egal, ich habe eine große Familie, wir gehören zusammen, niemand wird uns trennen, was immer auch kommen mag. Und so haben wir es auch weiter gehalten.
Bei Alija traf ich eine Witwe, Miramkul. Wir unterhielten uns, sie gefiel mir. Ihre Lebenserfahrung, ihre Abgeklärtheit, sie war intelligent, das alles gefiel mir gut.
Nun kann man ja nicht einfach mit einer Frau ihres Alters sich in der Stadt sehen lassen. Sie arbeitete an der Universität, hatte Studenten. Wir richteten uns darauf ein.
So verschwand ich abends bei Alija, traf Miramkul, kam nachts wieder zum Schlafen zu Alija. Das praktizierten wir einen ganzen Urlaub lang.
Natürlich führte das zu komischen Situationen. Abends kamen manchmal Gäste, die sich mit mir unterhalten wollten. Wo ist er? Er ist nicht da. Warum nicht?
Im nächsten Jahr meinte ich, dass das nicht immer so weiter gehen kann. Ich zog zu ihr. Sie hatte ein altes, windschiefes Häuschen. Ihre Familie, zwei Söhne nahmen mich freundlich auf. Ihre Tochter war verheiratet, hatte eine Tochter und wohnte nicht bei ihr. Wir verbrachten die Zeit gemeinsam.
Ihre Familie war ebenso groß wie meine. Ihr Vater Abdurachman war ein großartiger Mensch. Er hat mir ausgezeichnet gefallen. Ihre Mutter ebenso. Sie sind inzwischen verstorben. Die Geschwister nahmen mich liebevoll auf. Wir trafen uns häufiger. Miramkuls Familie war eng miteinander verbunden. Bei Familienfeierlichkeiten ging es immer fröhlich zu.
Natürlich gab es kuriose Momente. Ihre Enkelin, Sere, benannt nach der Lieblingsgroßmutter Abais, liebte ich besonders. Sie ist ein eigenwilliges Mädchen, was mir gefiel. So fragte ich manchmal nach dem Mittagessen, wer mit mir in die Stadt geht Eis essen. Da sprang sie in ihre Schuhe und wartete ungeduldig bis ich endlich fertig war. Einmal gingen wir an einem kleinen Kanal entlang. Sere hatte ein Spielzeughandy in der Hand und sprach hinein. Eine Frau saß auf einer Bank und telefonierte. Ich sagte zu ihr, Sie telefonieren wohl mit dem Mädchen? Antwort: Ja, ich telefoniere mit Sere. ???
Ich dachte, woher weiß diese unbekannte Frau den Namen unserer Sere? Schließlich stellte sich heraus, dass sie eine Schwägerin von Miramkul war, wir uns schon einmal bei einer Familienfeier getroffen hatten, ich mich nur nicht an alle Leute erinnern konnte. Wer einmal an solchen Feiern teilnahm, weiß, welche Dimensionen das annehmen kann. Wir lachten über dieses Missverständnis.
Meine Abreise ging mit einer Frage an Miramkul einher. Wie soll es weitergehen? Wenn wir zusammen leben wollen, müssen wir heiraten. Sie bat sich Zeit für eine Antwort aus. Das ist nicht einfach ein Vorgang. Deutschland hat hohe Hürden aufgerichtet, um solche Fälle möglichst von Anfang an zu erschweren, wenn nicht gar zu verhindern. Wir würden also über ein Jahr auf die Zusammenführung warten müssen. Hilfe gab es in diesem Falle selbstverständlich ebenfalls von keiner Seite.
Im September bekam ich von ihr eine Mail, sie möchte heiraten. Wunderbar, ich freute mich. Als nächstes rief sie in der deutschen Botschaft in Almaty an und fragte, was für Papiere nötig werden. Sie wurden ihr aufgezählt. Nun ist es in Zentralasien nicht einfach so, dass man zu einer Behörde geht und die erforderlichen Papiere bekommt. Es dauerte eine gewisse Zeit, dazu kamen beglaubigte Übersetzungen. Schließlich flog sie nach Almaty in die Botschaft. Dort nahm man die Papiere in die Hand, sah sie an und meinte, dass eigentlich noch andere nötig sind. 1.500 km noch einmal zurück, andere Papiere besorgen, übersetzen lassen, eine reife Leistung deutscher Diplomatie. Der zuständige Parlamentarische Staatssekretär im deutschen Außenministerium saß im Vorstand des Vereins, der die Verbindungen zwischen beiden Ländern entwickeln soll. In dieser Zeit wurde er einmal etwas schärfer nach den Bedingungen befragt, wie die Visumserstellung funktioniere. Geschäftspartner bekommen nicht rechtzeitig ihre Papiere, andere Treffen müssen ausfallen wegen Ablehnung von Anträgen etc. Er reagierte etwas pikiert. Etwa so: Er habe sich wegen der häufigen Beschwerden einmal selbst für eine halbe Stunde in die zuständige Abteilung in der Botschaft gesetzt und zugesehen, wie die Mitarbeiter am Fließband innerhalb einer Minute über die Anträge entscheiden müssen.
Ich feixte vor mich hin. Es erinnerte mich an eine Episode aus meinem früheren Arbeitsleben. Der 1. September war in der DDR Weltfriedenstag. Wie erinnerlich, hatte die deutsche Wehrmacht am 1. September 1939 Polen überfallen und damit den Zweiten Weltkrieg begonnen. Wie ehrt man die Republik? Durch Höchstleistungen in der Produktion. Unser Rechenzentrum hatte eine nicht so hohe Auslastung. Wie erreicht man nun zu Ehren dieses Tages eine Höchstleistungsschicht? Wir sammelten Aufträge, sprachen mit den Kunden. Die vorher ihre Termine hatten, wurden gebeten, etwas zu warten bis zum 1. September, die danach ihre Termine hatten, wurden gebeten, ihre Aufträge einmal ausnahmsweise etwas eher einzureichen. Ergebnis? 330 Prozent Normerfüllung am 1. September! Die Tage vorher wurde kaum noch etwas abgearbeitet, ebenso dauerte es ein paar Tage, ehe die normale Schichtauslastung wieder eintrat.
Nun arbeitete die Botschaft in diesem Land nach dieser Methode. Vielleicht tue ich den Beamten Unrecht. Aber wer davon abhängig ist, kann das nicht mehr ohne Emotionen beschreiben. Ich war dankbar dafür, dass jemand diese Frage einmal in diesem Verein aufwarf.
Und ausgerechnet in dieser Zeit traf ich in Berlin nacheinander auf zwei Frauen, die interessant waren und mich angesprochen haben. Sie waren nach meinem Geschmack, es hätten wunderbare Beziehungen werden können. Aber ich hatte Miramkul. So habe ich mich ein wenig unentschlossen gezeigt, innerlich konnte aber keine Rede davon sein. Ich wollte nicht als ein harter Mann erscheinen, der ich nicht bin, andererseits alea iacta est – Miramkul. Diese Situation war mir unangenehm. Ich kann schlecht damit umgehen, vielleicht habe ich auch Fehler gemacht, sie mögen mir verzeihen.
In dieser Sache möchte ich ein paar Bemerkungen über mich einfügen. Ich bin monogam. Ich habe zwar durch die Umstände nacheinander mehrere Frauen gehabt, niemals aber zwei gleichzeitig. Meine Partnerin ist meine Partnerin. Selbstverständlich habe ich gesehen, wie Mann/man mit zwei oder sogar mehr leben kann. Aber das ist nicht meine Sache. Meine Frau kann sich auf mich verlassen. Und sollte es nicht mehr funktionieren, muss es sehr gewichtige Gründe für eine Trennung geben. Solche Umstände waren nicht eingetreten, also konnte sich Miramkul auf mich verlassen. Es gab überhaupt keine Frage dazu. Vielleicht erscheint das hier als Rechtfertigung, ist aber nicht so gemeint.
Bei einer Veranstaltung des Vereins später ausgerechnet zum Thema Frauen gab es dazu eine bissige Bemerkung. Ich kam mit meiner Frau, die gerade aus Zentralasien angereist war und einer ehemaligen Lebensgefährtin. Die beiden Frauen verstanden sich gut miteinander. Meine Ehemalige hatte mir geholfen, sie war Russischdolmetscherin. Also warum sollte ich sie nicht mitbringen?
Und so hörte ich tuscheln, dass ich wohl mit meinem Harem gekommen sei. Naja.
Die Papiere für das Heiratsvisum wurden später noch einmal durch die Botschaft moquiert. Für einen Menschen, der eine Frau aus dem Land seines Vaters heiraten möchte, sind diese Vorgänge unverständlich. Aber was ist an deutschen Behörden überhaupt noch verständlich?
Ich rief einmal in der Botschaft an. Da traf ich auf eine örtliche Angestellte. Nachdem die mich regelrecht angeblafft hatte, sagte ich ihr, dass ich deutscher Staatsbürger bin, Steuern dafür bezahle, dass sie mich aus Almaty anbrüllen kann. Das gehe doch wohl nicht. Da wurde ich weiter verbunden.
Naja, deutsches Botschaftspersonal, das ist auch so eine Frage. Der Botschaftsrat, von dem ich hier schon schrieb, war wohl eine Ausnahme. Ich kann das nicht richtig beurteilen, weil ich zu wenige kenne. Aber manchmal kam ich schon ins Grübeln.
Meine ehemalige Braut nahm einmal an einem dieser Wetscherinkie teil. So wurden abendliche Treffen mit Botschaftsangehörigen bezeichnet. Nach einem solchen Abend schrieb sie mir eine Mail. Eine Gruppenleiterin hatte gesagt, dass nur farbige Männer Frauen richtig befriedigen können! Es verbietet sich wohl von selbst, mehr darüber zu schreiben.
Nach über einem Jahr endlich bekam Miramkul ihr Heiratsvisum. Ich organisierte die Flugtickets, sie reiste an.
Ich stand in Tegel auf dem Flughafen. Neben mir der deutsche Mann der kasachischen Funktionärin, die den Verein geschäftsführend vertrat. Wir unterhielten uns kurz, dann sahen wir die beiden Frauen. Nachdem sie die Kontrollen durchschritten hatten, hielt ich meine Frau im Arm. Endlich.
Wir sprachen alle vier noch kurz miteinander. Da wurde ich durch die Vereinsfunktionärin gefragt, wo denn Miramkuls Koffer seien. Es gab sie nicht. Aber das habe ich inzwischen verstanden, das kommt in zentralasiatischem Denken nicht vor. Nichts haben? So etwas heiratet man nicht.
Ich ja.
Die nächste Zeit war ebenfalls durch unglückliche Umstände gekennzeichnet. Am darauf folgendem Wochenende gingen wir einkaufen. Sonnabendnachmittag trafen wir in meiner Wohngegend wieder ein. Alles war zugesperrt, Polizei, Sperrgitter. Ich fuhr das Auto auf einen Parkplatz neben der Stadtautobahn, wir nahmen die Netze und Beutel in die Hand und blieben hinter der Polizei. Man muss sich das so vorstellen – vorn eine Nazidemonstration, dahinter die Gegendemonstration einschl. Bürgermeister etc. Danach Polizei, 50 Meter niemand, wieder Polizei, wir trotteten hinterher. Auf der Straße neben uns fuhren Wasserwerfer der Polizei, Räumpanzer. Eine Art Bürgerkrieg. Ich trug in beiden Händen schwere Beutel, meine Braut ebenfalls. Es kam zu einer Stockung. Ich lehnte mich an eine Bushaltestelle. Eine Gruppe von Polizisten stand in ungefähr 20 Metern entfernt. Da löste sich aus ihr eine blonde Polizistin. Sie nahm ihren martialischen Gummiknüppel hoch, näherte sich mir, hielt den Gummiknüppel unmittelbar unter meine Nase und fauchte mich an: Wenn Sie nicht sofort Ruhe geben, passiert hier etwas!
Ich schaute auf meine Braut. Was sollte ich sonst tun? Sie wechselte die Gesichtsfarbe. Ich stand da, konnte nichts tun. Nach einiger Zeit nahm die Polizistin den Gummiknüppel nach unten und entfernte sich.
Später erklärte ich Miramkul, dass es in Berlin schon häufiger passiert sei, dass nicht die Leute, die provozieren, sondern Unbeteiligte durch die Polizei zusammengeschlagen wurden. Der Polizeipräsident, der einmal öffentlich mit diesen Vorwürfen konfrontiert wurde, erklärte, dass die Vorwürfe zu 97 Prozent nicht zuträfen. Es war also nichts besonderes passiert, das normale Leben in Berlin. Wer aus Zentralasien kommt, wird das sicher anders einordnen.
Ehrlich gesagt, ich hatte mit dem, was kommt, nicht gerechnet. Ich hielt es auch in einer zivilisierten Gesellschaft für nicht möglich. Aber nachdem ich mich manchmal in den Arm gekniffen habe, musste ich mich mit der Realität abfinden.
Also Einwohnermeldeamtsmeldung, danach Standesamtsmeldung. Warten auf einen Bescheid eines Kammerrichters, dass wir keine Scheinehe eingehen. Wie er das feststellen möchte, wird wohl sein Geheimnis bleiben.
Meine Frau sollte selbstverständlich ein Mobiltelefon erhalten. Ich versuchte es mit meiner Telefonfirma. Sie benötigt dafür ein eigenes Konto.
Hier muss jetzt eingeschoben werden, dass sie ungefähr 14 Tage nach Ankunft einen Deutschkurs belegt hat. Da traf sie natürlich ebenfalls Frauen, die Deutsche heiraten wollten und den Sprachkurs belegten.
Eine Ukrainerin erzählte ihr, dass sie ganz einfach ein Konto bei der Berliner Sparkasse erhalten hat. So gingen wir zu einer Filiale in meiner Wohnortnähe. Wir wurden von einer großen blonden Frau empfangen. Sie forderte den Pass. Sie fragte, ob meine Frau deutsch könne – Sie lernt es. Was??? Sie kann kein Deutsch? Das muss ich ablehnen. Ich sagte, dass wenn es Probleme geben könnte, ich die Sachen regeln könne. Sie! Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, ob Sie das richtig übersetzen! Nein – ihre Frau bekommt bei uns kein Konto!
Was soll man dazu sagen, die leben ihren Rassismus aus? Ihr Herrenmenschentum? Wir fragten ihre Freundin noch einmal. Völliges Unverständnis. Wir gingen in die nächste Filiale der Berliner Sparkasse. Dort wurden wir wie Kunden empfangen. Was möchten Sie? Ein Konto? Selbstverständlich, nehmen Sie doch Platz, haben Sie Fragen dazu etc.
Miramkul hat ein Rotes Diplom. In der ehemaligen Sowjetunion war das ein Zeugnis dafür, dass sie im Studium nur ausgezeichnete Leistungen in jedem Fach hatte. Aber was heißt das schon hier? Nichts. Sie war Sprachlehrerin, hatte schließlich den Deutschkurs mit Auszeichnung abgeschlossen.
Nach der dreimonatigen Wartezeit traf die Bescheinigung des Kammerrichters, dass wir keine Scheinehe eingehen, nicht ein. Das Visum lief ab. Also in die Berliner Ausländerbehörde. Dort saßen wir. Die Leute im Warteraum kamen und gingen. Nur wir wurden nicht aufgerufen Nach zwei Stunden waren wir endlich dran. Der Mitarbeiter saß, das hatte ich noch nicht gesehen, mit den Füßen auf dem Schreibtisch und meinte lakonisch, dass er für uns nichts tun könne, da unsere Unterlagen nicht da seien. Ich sah in an und fragte – Was denn, dafür lassen Sie uns zwei Stunden warten? Er nahm die Füße vom Tisch richtete sich auf und sagte drohend: Ihren Fall werde ich genau prüfen! Da wird sich ja was finden lassen, was nicht in Ordnung ist.
Ich sah auf Miramkul. Sie wechselte die Gesichtsfarbe. So hatte sie sich Deutschland offensichtlich nicht vorgestellt. Ich war gewarnt. Ausländische Freunde hatten mir schon gesagt, die Ausländerbehörde Berlin ist eine Ausländerverhinderungsbehörde. Ich schrieb dem Leiter einen Brief, so etwas lasse ich mir nicht gefallen. Kurze Zeit später traf die Entscheidung des zuständigen Kammerrichters ein. Meine Frau sei nicht heiratsfähig, da sie verheiratet sei. Was soll man dazu sagen? Ich wollte schon eine Beschimpfung loslassen, besann mich und schrieb freundlich, dass er doch noch einmal nachsehen möchte, vielleicht das Standesamt noch einmal nach der Vollständigkeit der Unterlagen fragen möchte. Wenn es irgend einen Zweifel an der Heiratsfähigkeit meiner Frau gegeben hätte, wäre sie nicht nach Deutschland eingereist. Schließlich haben vor ihm vier Behörden die selben Unterlagen geprüft und bei Zweifeln hätte es keine Einreise gegeben.
Endlich gab auch er sein Plazet. Wir gingen zum Standesamt. Es ging nunmehr um Heiratstermin und die Modalitäten.
Der Termin ließ sich schnell finden. Danach die Modalitäten. Ich wollte eine Reihe von Leuten dafür einladen, habe extra zentralasiatische Musik auf eine CD aufgenommen – ein Fest organisieren. Alles war besprochen, da sagte die Standesbeamte, dass die Abwicklung der Feier davon abhänge, wer an diesem Tag Dienst habe ??? Sie habe eine Kollegin, die solche Feiern nicht möchte. Dann wird das nichts damit.
Ich schluckte. In Deutschland heiraten die Leute nicht mehr, weil die Konditionen derart schlecht sind und hier bestimmt eine Kollegin, was sie erlaubt?
Eine kurze Verständigung mit Miramkul, eine Feier, die abhängig von der Laune einer Standesbeamten ist, das machen wir nicht.
Ich habe in Zentralasien an vielen Hochzeiten teilgenommen, da kamen die Standesbeamten in das Restaurant, in dem die Feier stattfand. In Deutschland bestimmen diese Beamten, wie die Feier stattfindet. Ehrlich gesagt, ich war erschüttert. Demzufolge fanden die Feierlichkeiten anderwärtig statt. Wer lädt Gäste ein, um ihnen vielleicht sagen zu müssen, dass alles nur von der Laune einer Standesbeamtin abhängt?
Nun, eines Tages waren wir auch standesamtlich getraut. Miramkul erhielt ein längerfristiges Visum, wir konnten nun unser Leben ohne vorläufige amtliche Probleme beginnen.
Ich hatte eine Frau aus dem Lande meines Vaters. Sie war so, wie ich es mir nicht vorzustellen wagte. Sie war großartig. Natürlich sind alle Frauen einmalig. Sie entsprach meinen Vorstellungen. Meine Freunde und meine anderen Bekannten meinten, dass sei eine gute Verbindung.
Natürlich wissen wir, alle Partnerschaften funktionieren, weil es gute Voraussetzungen gibt, weil man miteinander gut harmoniert, das alles war gegeben. Und so ist sie mir in mein Herz gewachsen.
Es ging eine gewisse Zeit gut. Dann stießen wir an Grenzen, die von mir nicht zu überwinden waren. Ich hatte eine gut bezahlte Arbeit. Sonst wäre die Einreise meiner Frau überhaupt nicht möglich gewesen. Mein Chef fing an, keine Gehälter mehr auszuzahlen. Die einfachen Beschäftigten waren schon mehrere Monate ohne Zahlungen, jetzt erhielt auch ich kein Geld mehr.
Wir lebten eine Weile von meinen Reserven, aber es war abzusehen, dass es so nicht dauerhaft geht.
Miramkul wurde in eine Behörde bestellt. Angefordert waren natürlich ihre Papiere. Die Bearbeiterin, sie war vielleicht Anfang Zwanzig, nahm diese in ihre Hand und warf sie lässig über den Tisch. Mehr haben sie nicht? Ein Rotes Diplom war nichts. Ich fragte, was meine Frau realistisch erwarten könne: Putzen gehen. Ich sah Miramkul in die Augen. Sie beugte sich langsam zu mir hin und fragte leise, ob sie das richtig verstanden habe. Ja.
Wir gingen nach Hause. Ich wusste, jetzt geht alles zu Ende. Ich habe das verstanden. Als Lehrerin an einer Universität mit Studenten – und in Deutschland putzen gehen.
Es dauerte ein paar Tage, dann sagte sie mir, dass sie nach Hause zurück möchte. Ja – selbstverständlich. Ich hatte es verstanden, hätte es mit mir auch nicht machen lassen.
Es war ein schicksalhafter Entschluss. Eine Frau, mit der man sich vollkommen versteht, man kann sich keine bessere für sich vorstellen, geht nach Hause. Auch hier, so dachte ich, habe ich keinerlei Hilfe erfahren.
Sie flog im Frühjahr nach Hause, im Sommer flog ich für drei Monate nach Kysylorda. Wir verlebten glückliche Wochen, das Ende war abzusehen. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Für mich war es eine Katastrophe.
Man stelle sich das vor – ich konnte nicht in das Land meines Vaters gehen, sie konnte unter den gegeben Umständen hier nicht leben. Für uns beide gab es keinen gemeinsamen Platz in unseren Ländern. Und das im 21. Jahrhundert.
Wenden wir uns der Stadt Kysylorda zu. Es ist die Stadt meines Vaters, sie wurde auch meine Stadt. Gelegen in der Steppe am Syr Darja, inzwischen mit fast 200.000 Einwohnern, ist sie die Stadt in Zentralasien, mit der ich verwuchs. Anfangs sah ich sie ein wenig von oben herab an, inzwischen hat sich mein Verhältnis zu ihr geändert.
Sie hat keine imposanten Bauwerke, sie lebt einfach.
1999 war ich das erste Mal dort. Alles war neu für mich, ein wenig angestaubt, das gleich in mehrfachem Sinne. Die Stadt erlebte von da an einen enormen Aufschwung. Es wurde gebaut, die Straßen hergerichtet, die Ufer des Flusses neu gestaltet. Sie ist eine prosperierende Stadt.
Und bei der Betrachtung der Entwicklung kommt man nicht umhin, die Veränderungen zu konstatieren. Hier sollen einige aufgeführt werden.
In der Anfangszeit war ich immer in Begleitung, die Familie, wir fuhren zu einem Verwandten oder auf den Aul. In den späteren Besuchen eroberte ich mir die Stadt allein. Als erstes gehe ich in Buchläden. Es interessiert mich im Ausland immer, was die Leute so lesen. Kysylorda hat zwei größere davon. Anfangs standen deutsche Sprachlehrbücher, ebenso Romane und andere Literatur in Deutsch herum. Im Laufe der Zeit wurde das immer weniger. Bis ich schließlich so um 2008 keinen einzigen gedruckten deutschen Buchstaben mehr vorfand. Im Gegenzug nahm die chinesische Literatur zu. Einmal habe ich einen verantwortlichen Politiker hier in Berlin damit konfrontiert. Der sah das natürlich nicht so. Aber meine Inaugenscheinnahme entsprach den Realitäten.
Kulturinteressiert wie ich bin, besuchte ich die Konzerte und Theateraufführungen. Ich war zwar immer im Sommer dort, in dieser Zeit waren Theaterferien, aber es gab trotzdem einige Aufführungen, die ich mit großem Interesse verfolgte. Theaterstücke wurden in der Landessprache aufgeführt, sie ist mir unverständlich. Ich hatte meine Frau dabei, die mir manchmal etwas erklärte. Ansonsten sprachen die Aufführungen für sich. Bühnenbilder und Kostüme waren interessant, die Aufführungen waren geschickt inszeniert. Alles hatte ein bemerkenswertes Niveau.
Über eine Aufführung schrieb ich in Berlin für eine kleine Zeitschrift einen Artikel. Es ging um Korruption.
Einmal erlebte ich sogar zwei Aufführungen in einer. Das war eine neue Erfahrung, sie brachte mich auf die eigentliche Benennung – Khanat. Der Akim von Kysylorda, also der Regierungschef des Gebietes, sah sich das Theaterstück ebenfalls an. Aber was heißt das schon? Der Khan weilte der Aufführung bei, so die exaktere Beschreibung. Er hielt im Theater Einzug und Hof.
Das Stück war von Iran Gayip, einem Schriftsteller, den ich mehrfach in Berlin traf und jedes Mal auch sprach. Es ging um ein nationales Ereignis aus der Geschichte der Landes. Durch tragische Ereignisse gezwungen, verbanden sich die Khane zu Bekämpfung der auswärtigen Gegner und schufen so die Voraussetzung für eine nationale Einigung.
Im Sommer ist es in der Stadt sehr heiß. Ohne Kopfbedeckung ist es nicht möglich, sich dort zu bewegen. Trotzdem liebte ich es, am frühen Nachmittag in die Stadt spazieren zu gehen.
Langsam bekamen die Nachbarn und Freunde mit, dass ich immer wieder kommen würde und sie begannen mich bei neuerlichen Besuchen freundlich zu begrüßen. Oh – Du bist wieder da? Komm, wir trinken einen Tee! Einladungen zu Essen, wie man einen guten Bekannten begrüßt. Manchmal sagte ein Taxichauffeur – Ich habe Sie schon im vergangenen Jahr gefahren und so weiter.
Ich wurde zu einem regelrechten Einwohner. Ich spazierte durch die Stadt, ging auf den Basar einkaufen, überall traf ich Verwandte und Bekannte. Manchmal wurde es schwierig, sie einzuordnen, aber darüber schrieb ich schon. Ein Taxichauffeur fragte mich, was die Anzeige auf seinem Tachometer bedeutet. Er fuhr einen alten Opel, da stand, dass das Auto wieder zur Inspektion muss. Ich übersetzte es ihm. Wir lachten gemeinsam darüber. Die Vorstellung, dass dieses Auto noch einmal in eine Inspektion kommt, war unter diesen Umständen umwerfend.
Durch die große eigene Verwandtschaft, ebenso noch die meiner Frau, kam es dazu, dass ständig Familieneinladungen erfolgten. Es wurden Geburtstage, Hochzeiten gefeiert, aber ebenso ging ich ins Krankenhaus, manchmal starben Verwandte.
War ich anfangs nur eine Woche dort, verlängerte ich die Aufenthalte bis zu fast drei Monaten.
Ich hatte das Gefühl, dort bin ich ebenfalls zu Hause.
Das Reisebüro, in dem ich meine Rückflüge nach Almaty buchte, empfing mich immer mit freudigen Gesichtern.
Wenn ich Zeit hatte, ging ich im Fluss baden. Auch dort wurde ich schon mit Handschlag begrüßt. Nie hatte ich Schwierigkeiten mit Behörden. Manchmal ging es etwas kurios zu, aber immer fand sich eine freundliche Regelung.
Einmal war ich baden, kam aus dem Wasser, da kamen zwei Polizisten auf mich zu. Ihre Papiere bitte! Ausländer sind verpflichtet, ständig ihren Pass bei sich zu führen. Ich meinte, ich sei aus Berlin, wohne bei meiner Frau, zeigte auf das Haus, das nicht weit entfernt war. Zum Baden nehme ich meine Papiere nicht mit, ob er das nicht verstehen könne.
Ein Polizist fragte, was ein Deutscher ausgerechnet in Kysylorda am Strand des Syr Darja mache – Baden natürlich! Ich erzähle von meinem Vater, dass ich ein Koscha sei und nun hier für längere Zeit zu Besuch bin. Sie verabschiedeten sich freundlich.
Kysylorda hat ein Museum. Selbstverständlich besuche ich es.
Dort gibt es ein Foto, auf dem ein Onkel von mir, der leider schon verstorben war, der Schriftsteller Kaltai Mukhamedzhanov, mit Dschingis Aitmatow arbeitend zu sehen ist. Sie schrieben an einem gemeinsamen Buch “Der Aufstieg auf den Fudschijama» („Восхождение на Фудзияму“, 1973).

Einmal traf ich einen Maler, der Restaurationsarbeiten vornahm. Wir unterhielten uns und er zeigte mir seine Bilder. Ich wählte eins aus, um es in Berlin in meinem Zimmer aufzuhängen. Er bekam seinen geforderten Preis, er war nicht hoch, ich bat um eine Bescheinigung. Er schrieb mit Kugelschreiber, dass er, der Künstler Jassauiy, mir dieses Bild verkauft hat. Beim Rückflug nach Berlin auf dem Flughafen in Almaty zeigte ein Zöllner auf mich und bat mich mitzukommen. Er wollte wissen, was in dem großen Paket eingewickelt sei. Ein Gemälde. Ihre Bescheinigung dafür bitte! Ich kramte den Zettel hervor. Soll ich Ihnen einmal zeigen, was dafür notwendig ist?! Er ging zu einem Schrank, holte einen Ordner heraus und hielt mir ungefähr vier oder fünf beidseitig beschriebene Blätter mit einer Reihe von Stempeln unter die Nase. Das ist notwendig! Es war nachts drei Uhr. Ich fragte ihn, woher ich das jetzt bekommen könne. Es war mehr rhetorisch gemeint. Er nahm meinen Pass in die Hand, blickte auf meine beiden russischen Vornamen und fragte - Landsmann? Naja, es war ein deutscher Pass, den er in der Hand hielt. Ich sprach schlecht und mit eindeutig deutschem Akzent. Ich sage – Koscha! Wie bitte? Ja – ich bin ein Koscha. Er wedelte mit dem Pass in der Hand herum, begann breit zu grinsen, gab mir meinen Pass und machte mit der Hand eine Bewegung, die ich nur so deuten konnte, dass ich verschwinden solle. Was ich natürlich sofort tat.
Wenn ich mich mit Reisenden unterhalte und sie auf den Zoll zu sprechen kommen, erzähle ich, dass diese Beamten mir noch nie etwas getan haben und ich ihre Aufregungen dazu nicht verstehe.
Die Abflüge aus Kysylorda haben sich ebenfalls manchmal interessant gestaltet.
Einmal stand ich abgefertigt in der Wartehalle, die ist in der ersten Etage, blickte auf die Familie herab und winkte. Neben mich trat ein Mann, etwas so groß wie ich und fragte mich erstaunt, was ich mit einer solchen einheimischen Familie zu tun habe. Wir unterhielten uns. Er war aus Prag, war in die USA emigriert und arbeitete nun für eine kanadische Ölfirma. Wir unterhielten uns über Prag, was ich gut kannte. Anschließend fragte ich ihn, was er in Kysylorda gemacht hatte. Er war ein Spezialist für die Untersuchung von Ölfeldern. Sie wollten wissen, wie groß das Feld war und wie viel noch an Förderung zu erwarten sei. Wie machen Sie das? Wir senden Wellen in die Erde und an der Antwort können wir die Mächtigkeit feststellen. Wie genau sind denn diese Methoden? Ungefähr 20 Prozent. Aha, und wie sieht das hier aus? Kysylorda schwimmt auf Öl, das wird einmal eine richtige Boomtown.
Eine deutsche Gesellschaft leistet Entwicklungshilfe in aller Welt, so auch in Zentralasien. Als ich einmal in den letzten Jahren nach Kysylorda kam, wurde ich von der Familie mit einer Annonce empfangen. Ein unbenannte Firma sucht holländische und deutsche Spezialisten. Jeder weiß ja, wenn man unspezifische Spezialisten sucht, das kann sich nur um eine Verlegenheitsannonce handeln. Man sucht einen Bau-, Kommunikations,- Landwirtschaftsspezialisten. Was sonst.
Mit Miramkul suchte ich diese Firma auf, es war eine Außenstelle besagter deutscher Organisation. Wer sich Kysylorda etwas näher ansieht, findet natürlich sofort Möglichkeiten der Hilfe, deutsches Wissen, deutsche Organisation, so wie die Älteren von uns sie noch kennen.
Der Chef war verreist, zwei Mitarbeiterinnen unterhielten sich mit mir. Betriebswirt, komplexe Computerkenntnisse, einigermaßen Russisch. Was sucht man da noch. Die beiden Damen waren begeistert. Eigentlich hätte alles funktionieren können. Es wurde verabredet, dass sie sich melden. Meine Familie hatte wieder große Hoffnungen, ich war völlig entillusioniert. Auch hier muss wohl nicht extra gesagt werden, dass wir auf diesen Anruf heute noch warten.
Als die Deutschen noch in Kysylorda Öl förderten, bat mich meine Schwester Mira, einmal mit ihrem Chef zu sprechen. Ich tat das, aber natürlich anders als sie sich das vorstellte. Es war ein junger Mann aus Ostdeutschland. Wir unterhielten uns über seine Arbeit, er erzählte ebenso über die Probleme, die sie dort hatten. Schließlich gab er eine Prognose für den Ölpreis ab. Ich hatte sie mir gemerkt. Und als ich ein Jahr später ihn wieder aufsuchte, gratulierte ich ihm zu seiner Weitsicht. Der Preis hatte sich so entwickelt, wie er es vorausgesagt hatte. Ein Jahr später war er nicht mehr da.
Die Deutschen sind verschwunden, ebenso die Amerikaner und die Kanadier. Ich unterhielt mich mit einem Deutschen, der an der Ölförderung beteiligt war. Ich traf ihn wohl 2009. Er beklagte sich, dass die westlichen Firmen nicht zu einer Gemeinsamkeit gefunden haben und sich so von den Einheimischen haben spalten, gegenseitig ausspielen und vertreiben lassen. Es war ja in der Stadt sichtbar geworden.

Wenn wir am Abend am Ufer des Syr Darja spazieren gingen, kamen uns immer mehr Chinesen entgegen. Bei einer ersten Begegnung grüßte ich die freundlich lächelnden Chinesen und fragte, ob sie russisch sprechen. Keine Reaktion. Englisch? Ebenfalls nicht. Miramkul fragte nach der Landessprache. Ebenfalls nicht. Vor dem Firmengebäude hängen die Fahnen beider Länder und der gemeinsamen Firma.
Kontakte mit ihnen waren also nicht möglich, weshalb ich abends bei unseren Begegnungen mit einen fröhlichen „Guten Abend“ grüßte. Sie antworteten in ihrer Sprache ebenfalls fröhlich.
Ich fragte Miramkul, welche Sprachen die Studenten jetzt an der Universität belegen. Englisch selbstverständlich. Und weiter? Ein paar ganz Wenige noch Französisch. Deutsch kommt nicht mehr vor.
Anfangs baten mich ein paar Leute, ich möchte doch für sie in Deutschland Waren, Firmen, Verbindungen organisieren. Als ich mich das erste Mal darauf einließ, sah ich sofort, das artet in Arbeit aus. Ich hätte ein Büro einrichten und wenigstens jemanden dafür einstellen müssen. Das ging natürlich nicht. Später verwies ich die Leute auf die Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Almaty. Das lehnten sie ab, mit denen zusammenzuarbeiten. Institutionen in der fernen Hauptstadt sind nicht vertrauenswürdig.
Und so kam ich zu dem Eindruck, dass die deutsche Politik dieses Land ohne Not einfach aufgegeben hatte. Die Entwicklung, die ich wahrnahm, ließ keinen anderen Schluss mehr zu.
Bei einer Reise vor ein paar Jahren, es ging schon um das Filmprojekt, von welchem weiter unten noch berichtet wird, wurde mir nach einem Besuch der neu erbauten Moschee in Kysylorda ein Mann vorgestellt, der sehr freundlich mit mir sprach. Es war ein Nachbar meiner Schwester Alija, der inzwischen nach Astana gezogen war. Er hatte von unserem Schicksal gehört und es hatte ihn beeindruckt. So versprach er zu organisieren, dass eine kleine Sendung im Regionalfernsehen darüber erscheinen wird. Ein paar Tage später meldete sich eine Journalistin, Bajan, der ich einen Text, der einem Film zugrunde gelegt werden soll, zum Lesen gab. Ich bat sie, für das Interview ein paar Antworten durchdenken zu können, da ich mit meinem Russisch ein wenig Vorbereitung dafür benötige. So trafen wir uns bei Alija, sie machten ein paar Aufnahmen, ein Interview und gaben unserm Familienoberhaupt Almachan und meinen Schwestern Gelegenheit, ihre Freude zum Ausdruck zu bringen.
Ein paar Tage später lief es im Fernsehen. Als ich am darauf folgenden Tag einkaufen ging, wurde ich auf der Straße, auf dem Basar, in den Geschäften, kurz überall von vielen Leuten angesprochen. Sie drückten mir ihre Freude darüber aus, dass ich mich 50 Jahre bemüht habe, meinen Vater und seine Familie zu suchen, nicht aufgegeben habe und mich nun der Familie, der Stadt und dem Land zugehörig fühlen würde. Es waren herzliche Begegnungen, selbstverständlich hatten alle Verwandten und Bekannten die Sendung gesehen.
Es war ein Fest, eine Freude, ein Zusammengehörigkeitsgefühl bei allen. Die Augen strahlten, Herzlichkeit, wo immer ich dazu angesprochen wurde.
Die mir näher standen wussten es inzwischen besser, es gab schon keinen Weg mehr für ein glückliches Zusammenleben. Der Präsident hatte monatelang einen Brief von mir zu liegen, den er nicht beantworten wird. Die Khane wollten das alles nicht.
Natürlich muss hier noch eine Bemerkung über Almaty gemacht werden. Das ist eine wunderschöne Stadt. Dort fühle ich mich ebenfalls wie zu Hause. Auch dort bewege ich mich wie ein Fisch im Wasser. Die kulturellen Möglichkeiten sind viel größer als in Kysylorda, was ich auch ausgiebig mit meiner Verwandtschaft nutze. Das Klima ist besser, die Stadt ist grüner, größer, weltstädtischer als Kysylorda. Eine Entscheidung, wo ich leben möchte, brauchte ich nicht zu fällen, das hatten mir die Khane abgenommen. Trotz aller Umstände, die in Kysylorda herrschen, aufgeführt sei als Beispiel noch die ungünstigen Umweltbedingungen durch den ausgetrockneten Aralsee, wollte ich hier zeigen, dass diese Stadt einen Platz in meinem Herzen hat.
Das Motto lautet für dieses Kapitel: Difficile est saturam non scribere.
Diese Familiengeschichte war für einige so interessant, dass sie zu einem Film verarbeitet werden sollte. Das erinnert natürlich bei diesem Land sofort an „Borat“. Die Unterschiede werden sichtbar. Hier handeln konkrete Personen, die aus dem Lande kommen. Was einmal hoffnungsvoll begann, ist in eindrucksvoller Weise zu Schanden geritten worden. Ein Film entsteht nicht, zumindest nicht unter den gegeben Umständen mit den dortigen Einrichtungen.
Noch eher erinnert diese Episode an den ukrainischen Schriftsteller Wolodymyr Drosd und seine Satire “Jossyps Himmelfahrt“. Leider konnte ich nicht mehr von ihm lesen, aber diese kleine Erzählung, die hatte es in sich. Sie beschrieb einen kleinen Jungen, der beschloss, später einmal Vorgesetzter zu werden. Und so begann er schon im Kindergarten seine Umgebung damit zu tyrannisieren. Eine perfekte Karikatur sowjetischer Leitungsmethoden, nach oben kriechen, nach unten treten. Der Junge scheiterte großartig, weil Befehle geben allein nicht ausreicht, nicht einmal im Sowjetsystem, man sollte immer wissen, was man tut und welche Wirkung das nach außen hat.
Hier füge ich etwas ein, eine Unterhaltung unter dem wunderschönen Kysylordinsker Nachthimmel mit den vielen leuchtenden Sternen, den unvermeidlich vorbei fliegenden Raumschiffen (Baikonur ist nur wenige Hundert Kilometer entfernt) nach Beschparmak, Kaffee, Tee und Danksagung. Wir saßen im Hof und ein Mann mittleren Alters erzählte:
Bei uns beginnt sich langsam etwas zu ändern. Früher war es so, dass der Chef in der Arbeitsberatung sagte: So wird es gemacht! Alle standen auf und gingen an die Arbeit.
Danach kam die Phase, da der Chef sagte: So wird es gemacht! Zögernd meldete sich der Fachmann, der die Arbeiten ausführen sollte und meinte: Chef, wäre es nicht besser, wir würden es etwas anders machen? Es wird so gemacht, wie ich es gesagt habe!
Jetzt ist die Zeit, in der der Dialog ebenso läuft, aber am Schluss, wenn alle aufstehen, um an die Arbeit zu gehen, der Chef meint: Es wird so gemacht, wie der Fachmann es gesagt hat!
Ehrlich gesagt, da habe ich mich erfreut.
Bei dieser Filmgeschichte wird es nicht so kommen. Hier ist niemand vernünftig dem Hauptakteur in den Arm gefallen. Im Gegenteil.
Aber der Reihe nach.
Ganz am Anfang steht ein Freund eines Schwagers, der war Kameramann in Almaty bei einem privaten Fernsehsender. Er schlug vor, ich solle doch einmal darüber nachdenken, ob das nicht eine Geschichte wäre, die man verfilmen könnte. Die Eindrücke waren frisch, ich war noch nicht dazu bereit.
Wie schon einmal erwähnt, unterhielt ich mich später mit Didar Amentai in Berlin. Er kam darauf zurück, suchte Kontakt mit mir und schlug vor, einen Film aus meiner Familiengeschichte zu machen. Ich war einverstanden, wollte aber keine Verwurstung. Nach einigen Mails verstummte er plötzlich.
Etwas später kam eine Journalistin zu den Berliner Filmfestspielen und bat um ein Interview. Ich traf mich mit ihr. Als Übersetzerin brachte ich meine ehemalige Lebensgefährtin mit. Wir saßen in einem Hotel im Stadtzentrum von Berlin. Ich machte Fotos, bezahlte den Kaffee. Wir unterhielten uns lange. Ich erzählte unsere Geschichte, sie hörte zu, machte sich ein paar Notizen. Schließlich bot ich ihr an, sie solle das Interview aufschreiben, mir als E-Mail schicken, wir korrigieren es und schicken es zurück zur Veröffentlichung. Wir verabschiedeten uns, alles schien in Ordnung. Am nächsten Tag schickte ich ihr die Fotos. Lange war nichts zu hören und zu sehen. Die Filmfestspiele finden im Februar statt. Im August bekam ich von der Verwandtschaft aus Zentralasien einen Zeitungsartikel mit einem Foto von ihr und mir, welches ich während des Interviews gemacht hatte und einen langen Artikel zu dem Thema. Aber ach, was hatte sie da nur geschrieben. Verwechselungen, Unrichtigkeiten, Fehler, Entstellungen, dazu unvollständig. Da war nichts zu machen. Bei den Festspielen im Jahr darauf war sie wieder da. In der Delegation war die Leiterin des Spielfilmbereiches vom Filmstudio aus Almaty. Ich fragte die Journalistin, warum sie nicht die angebotene Möglichkeit der Korrektur des Artikels genutzt habe. Sie blickte mich erschrocken an. Wir luden die beiden Frauen nach Hause ein.
Es wurde ein interessanter Abend. Die Studioleiterin machte einen guten Eindruck auf uns. Miramkul kochte ein heimatliches Essen – Manty.
Es wurde schon darüber gesprochen, dass ein Film entstehen sollte.
Eine Zeit später wurde ich in die Botschaft gebeten und man wollte wissen, wie ich über einen Film denke. Es sollte ein Dokumentarfilm entstehen, den der Direktor des Filmstudios selbst als Regisseur machen wollte. Ich sagte zu, stellte drei Bedingungen. Es soll ein seriöser Film werden, meine Mutter soll mit Achtung behandelt werden und der Film soll nicht in Deutschland gezeigt werden. Des weiteren schlug ich meine ehemalige Lebensgefährtin als Dolmetscherin vor. Wie ich schon einmal schrieb, sie studierte Russisch und Französisch, arbeitete ein Zeit lang als Dolmetscherin, arbeitete nach ihrer Promotion ein halbes Jahr in Moskau.
Der Botschaftsangestellte sprach mit Achtung von diesem Regisseur.
Zum Jahresende meldete sich der Regisseur, versprach eine Art Drehbuch und terminierte den Drehbeginn auf Mitte Januar.
Das neue Jahr begann, ein Drehbuch, Synopsis, wie auch immer, kam hier nicht an. Dafür der Regisseur. Wir holten ihn vom Flughafen ab. Er kam völlig ohne Gepäck, ein Mitarbeiter der Botschaft war ebenfalls dabei, der Regisseur war ein Freund des Botschafters.
Später kam der Kameramann aus Moskau. Auch er hatte wenig Gepäck. Eine Kameraausrüstung war vorhanden, eine Tonausrüstung nicht. Zusätzlich stieß zu den beiden eine Mitarbeiterin des Regisseurs. Sie hatte einen Titel, etwas mit Manager oder so, welche Aufgabe sie konkret hatte, wurde mir allerdings bis zum Schluss nicht deutlich.
Am Abend gaben wir zu Hause ein Essen. Gastgeschenke wurden ausgetauscht. Der erste Mann, den meine Mutter geheiratet hatte, arbeitete Anfang der 50-er Jahre des vorigen Jahrhunderts zuerst beim Dokumentarfilm. Später ging er in eine dramaturgische Abteilung beim entstehenden Fernsehen. Das Dokumentarfilmstudio hatten einen Film über die Sowjetunion gedreht - „Das russische Wunder“. Dazu gab es ein Filmbuch mit Fotos. Aus dieser Sowjetrepublik wurde darin berichtet, wie sich unter dem zaristischen Milieu, regional islamisch geprägt, das Leben abspielte. Nach der Oktoberrevolution begann ein Mädchen zu lernen, später Medizin zu studieren, selbst Professorin werdend, das Gesundheitswesen der Republik entscheidend zu entwickeln. Das war nicht die einzige Episode, aber diese habe ich mir gemerkt. Ich bekam eine Kassette mit Spielfilmen in der Landessprache.
Meine ehemalige Lebensgefährtin begann an diesem Abend mit ihrer Übersetzertätigkeit. Sie war entsprechend die ganzen Tage dabei, für den Regisseur dolmetschte sie außerdem eine Begegnung mit V. Schlöndorff, der einen Film mit diesem Filmstudio gedreht hatte, ebenso die Vorführung einer Rohfassung dieses Films. Davon später.
Wir verabredeten den Drehbeginn auf den nächsten Vormittag. Das Wohnzimmer wurde entsprechend umgestellt, ein provisorisches Mikrofon ausprobiert, die Kamera eingerichtet. Es sollte losgehen. Nun hielt ich erst einmal den Beginn auf. Ich wollte ein paar Sachen geklärt haben, über die nicht gesprochen worden war.
Was denn noch?
Gibt es einen Vertrag?
Nein, es gibt keinen Vertrag.
Gibt es Honorar?
Nein, es gibt kein Honorar.
Gibt es Rechte?
Nein, es gibt keine Rechte.
Gibt es Pflichten?
Nein, es gibt keine Pflichten.
Wenn Du kein Geld hast, hier in Deutschland gibt es Institutionen, zum Beispiel den Fernsehsender Arte, die fördern solche Projekte. Wende Dich an sie, die helfen.
Ich nehme kein Geld von Arte. Wenn Du Honorar möchtest, gebe ich Dir die Rechte am Film für Deutschland.
Nanu, hatte er etwas vergessen? Ich sagte nichts weiter dazu.
Gut, beginnen wir.
Hier möchte ich ein wenig über das einfügen, was ich von der dortigen Filmszene gesehen hatte.
Den ersten Film sah ich in Arte, er hieß „Ompa“. Zwei Piloten fliegen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion Passagiere mit einem uralten Doppeldecker. Dieser Film hat mich begeistert. Er war komisch, witzig, temporeich, traurig, sentimental, zeigte die Seele der einfachen Menschen. Ich war berührt davon. Es ist wirklich schade, dass dieser Film so einfach in der Versenkung verschwand.
Als nächstes lud mich eine Malerin, Almagul Menlibaeva, bei einem Fest ein, einen Film, der nebenher lief, mit anzusehen. Er war von ihrer Freundin Gulshat Omarova, der Titel „Schiza“. Hier ebenfalls ein gut gemachter Film. Das Land hat talentierte Filmemacher. Später in Berlin traten ein junger Produzent und drei ebenfalls junge Regisseure auf. Ihre Filme, Low-Budget, waren ebenfalls gut gemacht, zeigten die Talente und das Können dieser Leute. Ich erinnere mich an einen dieser Filme heute noch. Er hieß „Einfache Leute“. Zwei junge Männer schlagen sich durch das nunmehr geänderte Leben. Sie sind Straßenverkäufer in einer zentralasiatischen Stadt, hängen ihren Träumen nach einem besseren Leben nach, letztlich wird einer in die Provinz zurückgehen.
Auf diese Filmschaffenden werde ich später wieder zurückkommen.
Also war ich bester Laune auf unseren Film eingestimmt. Die Voraussetzungen für einen guten Film schienen gegeben.
Die Szenerie war eingerichtet und er setzte sich so, fragte in der Art, wie ich es mehrfach bei Günter Gauss schon in den 60-er Jahren gesehen hatte. Gauss war ein außerordentlich seriöser und erfahrener Journalist, der sich vorher über seine Gäste genau informiert hatte. Aber alles hat seine Zeit und das hier war ein Abklatsch, der nicht einmal originell war. Ich schwieg erst einmal dazu. Er wollte nach einigen Tagen meine Freunde, meine Mutter, einige Orte mit mir besichtigen und Befragungen vornehmen. Alle meine Freunde, selbstverständlich ebenfalls meine Mutter, waren dafür bereit und stellten sich zur Verfügung.
In der Vorbereitungsphase hatte er mir versprochen, dass nichts gezeigt wird, was ich nicht möchte. An einer Stelle hatte er seinen Kameramann mich in einer ein wenig intimen Phase filmen lassen. Nichts schlimmes, aber sehr nah. Am nächsten Morgen bei Drehbeginn sagte ich ihm, dass mir das nicht gefallen hat. Das interessiert mich nicht, ich mache, was ich will! Oho! So sieht das also aus.
Einen Abend lud uns der Botschafter zum Essen ein. Wir saßen in einem Restaurant in der Innenstadt. Er wollte von mir wissen, wie meine Geschichte war. Sein Gespräch begann er ungefähr so, dass wir uns doch schon einmal gesehen haben. In den Veranstaltungen des Vereins sah ich ihn viele Male. Fotos habe ich davon. Warum begann er auf eine solche Weise das Gespräch?
Wir aßen gut, er ließ nicht locker, wollte alles von mir wissen. Ich erzählte bereitwillig.
Eines Tages fuhren wir ins Erzgebirge. Am Abend vorher gab die Botschaft ein Essen in einem Berliner Restaurant. Da traf ich auf einen älteren Schauspieler aus Zentralasien mit seiner jungen Frau. Miramkul sagte mir, dass er sehr verehrt wird. Die Frauen verabredeten, dass sie diese Fahrt am nächsten Tag mitmachen wollen. Ich fragte meine Frau, ob sie denn nicht zur Schule gehe? Nein, wir haben gerade beschlossen, alle morgen mitzufahren. Einen Schultag mehr oder weniger war für sie ohne Bedeutung. Wie schon einmal an anderer Stelle erwähnt, beendete sie ihren Kurs mit Auszeichnung.
Es kam ein Kleinbus der Botschaft. Diese Fahrt hatte ich vorbereitet. Ich hatte unter Aufwendungen, da das Buch eigentlich vergriffen war, eine Chronologie der kleinen sächsischen Stadt besorgt und meine ehemalige Lebensgefährtin gebeten, auf der Autobahn davon in Russisch vorzutragen, sozusagen als Einstimmung auf die Stadt und die Zeit damals. Der Regisseur öffnete kurz die Augen, schloss sie wieder und schlief weiter. Nachdem wir nun gesehen hatten, dass das niemanden interessierte, hörten wir damit auf. Wenn man sich von Dresden her der Stadt nähert, kommt man eine Anhöhe hinauf und hat die Stadt vor sich im Tal und an einem Hang zu liegen. Wir hielten an, der Kameramann baute seine Technik auf und begann Aufnahmen von diesem schönen Stück Erde zu machen. Danach ging es in die Stadt.
Im Gebäude der ehemaligen Kommandantur sitzt heute die Polizei. Ich fragte, ob wir das Haus aufnehmen können. Ja, von außen können sie filmen was sie wollen.
Der Kameramann war ein netter Mensch. Leider war er ein wenig umständlich. Wenn er erst einmal sein Equipment aufgestellt hatte, dauerte es sehr lange, bis er wieder bereit war, es abzuräumen. So zogen sich die Stunden hin. Wir gingen zu einer ehemaligen Schulkameradin, auch sie wurde aufgenommen. Schließlich schien der Regisseur befriedigt gewesen zu sein, wir konnten wieder abfahren.
In Dresden besichtigten wir die wieder errichtete Frauenkirche. Spät kamen wir nach Berlin zurück.
So vergingen die Tage. Einmal wollte der Regisseur die Rohfassung des Schlöndorff- Filmes sehen. Die lag nur in Deutsch und Teile in Französisch vor. Meine Bekannte übersetzte auch das. Mit ihr fuhr er für ein paar Stunden zu Schlöndorff selbst, auch da übersetzte sie für ihn. Schließlich schienen die Arbeiten beendet zu sein. Ein Botschaftsmitarbeiter und ich begleiteten ihn zum privaten Einkauf in die Stadt.
Zum Abflug trafen wir uns noch einmal auf dem Flughafen. Zwei Kleinbusse der Botschaft brachten sein Gepäck, es musste auf eine größere Anzahl von Gepäckrollern umgeladen werden. Er ging zum Zoll, um die Umsatzsteuer für die gekauften Sachen zurückzuerhalten. Er nahm mich zur Seite, gab mir 300 Dollar und 300 Dollar für meine ehemalige Lebensgefährtin für ihre Dolmetscherarbeiten. Im Blick seine Einkäufe dachte ich, oje, was für eine Armseligkeit, Schäbigkeit.
Es sollte schlimmer kommen.
Natürlich wollte er, dass ich so schnell wie möglich anreise, damit die Dreharbeiten in Almaty fortgesetzt werden können.
Ich erhielt ein offizielles Schreiben des Filmstudios, das in der Sowjetunion einen großen Namen hatte, alle bedeutenden Regisseure arbeiteten dort, mit einer Einladung zur Fortsetzung der Arbeiten. Sie übernehmen die Kosten für die Bahnfahrt Berlin-Almaty-Berlin für mich allein.
Gerichtet war es an meine Frau und an mich. Man muss sich einmal vor Augen halten, die Bahnfahrt dauert etwas mehr als vier Tage. Fliegen dauert zwischen 6 bis 10 Stunden, je nach Route. Die Kosten beim Flug liegen in der billigen Klasse bei 600 bis 800 Dollar, er hätte also ungefähr 300 Dollar gespart. Dafür wäre ich über vier Tage unterwegs. Natürlich bekommt man während einer Eisenbahnreise Hunger und Durst, aber naja, es war sowieso undenkbar für mich. Er war der Direktor des größten Filmstudios, also nicht ein einfacher Mitarbeiter. Die Regierung hat eine neue Hauptstadt im Norden des Landes für viele Milliarden gebaut, hier hat das Filmstudio nicht einmal genügend Geld zur Verfügung, dass eine normale Reise ordentlich bezahlt werden konnte. 300 Dollar fehlten! Ich habe noch keinen getroffen, der für eine normale Reise den Zug genommen hatte. Damit gefahren sind die Deutschen, die aus dem Land ausgereist waren. Die hatten viele Koffer, sonstige Gepäckstücke, sogar Möbel mitgenommen, die niemals in ein Flugzeug gepasst hätten. Aber für ein paar Filmaufnahmen? Er – der Direktor des größten Filmstudios, Freund des Botschafters Kairat Sarybai und Freund des Akims von Kysylorda Muchtar Kul-Muhammed wollte mich zu einer Bahnreise nötigen, um Kosten zu sparen.
Das Schriftstück dazu habe ich natürlich aufgehoben. Es hat einen Ehrenplatz unter meinen Papieren.
Aber es ging weiter.
Ich hatte mir ungefähr Anfang Mai als Termin für die Reise vorgenommen. Ich wollte zwei Monate bleiben, die Familie besuchen, das Land, die Leute. Wie ich es schon im Kapitel über Kysylorda beschrieben hatte. Ich druckte aus dem Internet das Reiseformular aus, trug meine Daten ein, fuhr in die Botschaft und gab im Konsulat meine Unterlagen ab. Die Mitarbeiterin kannte ich natürlich, wir sahen uns zu Veranstaltungen des Vereins und der Botschaft. Sie meinte, ich solle doch eine Begründung dafür schreiben, weshalb ich länger bleiben wolle. Auf dem Rückweg rief sie mich an und bat darum, dass ich noch einmal vorbeikomme. Gut, wir besprachen etwas Formales. Ich fuhr nach Hause. Ich rief Rimma in Almaty an, dass ich nicht ohne weiteres ein Visum bekomme und deshalb noch nicht sagen könne, wann ich komme. Das hatte ich schon intus, dass ich ohne endgültige Papiere keinen konkreten Flug buchen konnte. Mein Freund Alexej mit seinem Reisebüro hatte viel Verständnis für mich. Einen Tag später erhielt ich die Nachricht, dass ich mein Visum abholen könne. Ich fuhr wieder zur Botschaft, erhielt das Visum, fuhr zu Alexej zum Buchen des Fluges. Er wurde durch die Zeitverzögerung zwar etwas teurer, aber ich war mit allem abgesichert. Ich rief wieder Rimma in Almaty an und sagte ihr, wann ich ankomme. Sie holten mich vom Flughafen ab und fragten mich ein wenig unwirsch, warum ich erst dem Regisseur sage, wann ich komme und nicht zuerst ihnen, der Familie. Er habe vor einigen Tagen angerufen und gefragt, wann ich eintreffe. Aha, der Regisseur erhielt seine Information vom Botschafter eher als ich mein Visum. Ist mir egal. Ich war jetzt da. Am nächsten Morgen, es war ein Sonnabend, rief ich bei der Mitarbeiterin des Regisseurs an, dass ich nun da bin. Wir treffen uns sofort morgen. Was natürlich nicht wurde, da es ein Sonntag war.
Wir trafen uns am Montag. Rimma wohnt im Rayon Almagul, das Filmstudio ist im gleichen Bezirk nur unweit entfernt. Ich wurde abgeholt. Nach der Begrüßung wurde mir der neue Regisseur für die Aufnahmen im Land vorgestellt.
Am 9. Mai, des Tag des Sieges, sollten die Aufnahmen im Panfilovpark gemacht werden. Dort steht ein Denkmal für die Opfer, die der Große Vaterländische Krieg vom Land gefordert hatte. Jedes Brautpaar fährt bei der Hochzeit zu diesem Denkmal. Es gibt keine Familie im Lande, die keine Opfer zu beklagen hat. Also ein würdiger Drehort für unsere Geschichte. Danach sollte ich mit der Bahn nach Kysylorda fahren. ??? Das dauert 24 Stunden, der Flug nur zweieinhalb. Kostenersparnis für das Filmstudio – ungefähr 40-50 Dollar. Ich bin noch nie mit der Bahn diese Strecke gefahren! Da meldete sich der sehr junge Regisseur für die Inlandsaufnahmen und meinte, er möchte das so, weil er Aufnahmen mit mir von der Landschaft machen möchte.
Wir machten die Aufnahmen im Panfilovpark. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder. Die Abreise nach Kysylorda stand unmittelbar bevor. Ich meinte, dass wir in Berlin meinen Neigungen in dem Film nicht nachgekommen waren. Ich besuche gern Konzerte, das hatten wir nicht geschafft. Wie wäre es, wenn wir das in Almaty machen würden? Gut, wir verschieben die Abreise um eine Woche. In Kysylorda, so versprach er mir, wird der Akim, sein Freund, ein Treffen der Koschas organisieren. Er sagte es mehrfach. Ich fragte mich, ob er sich überhaupt vorstellen könne, wovon er sprach.
Ich kenne den Mufti, ich bin ein Koscha, wollen wir das nicht auch noch aufnehmen. Anruf beim Mufti, er konnte in der darauf folgende Woche nicht. Also Abreise weiter verschieben. Das Telefon klingelte. Aha, der Regisseur muss unbedingt persönlich nach Nizza. Eine weitere Woche Verschiebung. Oje! Ihr seid Zentralasiaten, Ihr wisst, dass man überall Gast sein kann, aber der Gast hat auch Verpflichtungen, er darf seinen Aufenthalt nicht überdehnen!
Der Regisseur begann dem jungen Inlandsregisseur über den Film und über mich zu berichten. Er erzählte, dass ich mir nur schöne Frauen ausgesucht habe. Da stutzte ich. Das Äußere einer Frau kann doch niemals ein Auswahlkriterium sein.
Das glaube ich Dir nicht!
Der Regisseur hatte die Gelegenheit, sich mit meinen Frauen, meinen Freunden, meiner Mutter und weiteren Personen über mich zu unterhalten. Und zum Schluss kommt heraus, dass er mich nicht kennt, nicht versteht, mir nicht glaubt. Was soll das für ein Film werden? Ich erzählte dem Kameramann und dem neuen jungen Regisseur, dass ich mich bei einer Feier am Vorabend wohl erkältet habe. Da meinte der junge Regisseur, dass ich wohl Cognac getrunken habe. Das konnte ich nicht fassen. Er hatte dem Mann nichts von mir erzählt. Der wusste nicht einmal, dass ich keinen Alkohol trank. Da schüttelte selbst der Kameramann seinen Kopf.
Bei Rimma dachte ich über das Projekt nach. Kein Vertrag, keine Rechte, keine Pflichten, kein Geld für den Film, der Regisseur glaubt mir nicht, was ja bedeutet, dass er die ganze Geschichte auch nicht verstanden hat. Dazu der einheimische Regisseur ohne Ahnung - was soll das für ein Film werden? Ich erinnerte mich weiter, wie er mich angefahren hatte, weil ich diese Nähe bei einer bestimmten Aufnahmesituation nicht wollte.
Meine Schwester fragte mich, wer wir eigentlich für ihn seien? Er hatte einen Ton gegenüber uns angeschlagen, der sehr herrisch war.
Also sagte ich Rimma, wir gehen jetzt in ein Reisebüro, ich fliege sofort nach Kysylorda. Wenn er anrufen sollte, sag ihm, ich sei nicht mehr da. Dort erhielt ich die Auskunft, dass ich noch am Nachmittag fliegen könne. Ich wollte, aber meine Schwester Rimma war vernünftiger und so flog ich erst am nächsten Vormittag. In der Maschine atmete ich auf. Jetzt komme ich zur Familie, nach Kysylorda, werde mit Miramkul leben.
Rimma sagte ich, dass sie sagen soll, dass sie nicht wisse, wo ich mich aufhalte. Meine Schwestern in Almaty kannten die Koordinaten von ihr nicht.
Ich landete im Schoße dessen, was zu mir gehörte – Kysylorda, Familie, Nachbarn, Freunde, Fluss, der Aul. Ich war zu Hause. Jeder kennt das Gefühl, Du warst lange unterwegs, jetzt bist Du wieder zu Hause. Heimat? Ja auch Heimat.
Ich rief Rimma manchmal an. Sie sagte mir eines Tages, dass die Anrufe der Mitarbeiterin des Regisseurs immer aggressiver werden. Gut, lass Dir die Nummer geben, ich rufe zurück.
Ein paar Tage später bekam ich die Telefonnummer, die Mitarbeiterin wusste, dass ich sie anrufen werde. Da ich meine Unterkunft nicht preisgeben wollte, ging ich eines abends zur Post und rief über das öffentliche Telefon an. Wer ist da? Ich. Wo bist Du? Wir kommen sofort morgen! Aber bitte, höre mir doch erst einmal zu! Gut, wir kommen übermorgen. Nein! Ich werde Euch eine Mail schreiben, danach werdet Ihr wissen, warum ich abgefahren bin.
Ich setzte mich hin und schrieb eine E-Mail an den Regisseur. Da brachte ich das hinein, was ich hier angeführt habe. Sie ging noch ein wenig weiter. Zum Beispiel hatte er mir erklärt, dass er sich gründlich mit meiner Geschichte befasst habe, wir aber wissen, dass es dafür aber gar keine Grundlage gab. Was diese Journalistin geschrieben hatte, entsprach dem nicht im geringsten. Weiter diese Bezahlung meiner Bekannten. 300 Dollar bekommen in Berlin Dolmetscher für zwei Stunden. An Kompetenz hatte es nicht gemangelt, da er selbst ihr vorschlug, dass sie bei ihrem Können für die Botschaft zum Beispiel arbeiten könne. Sie hatte ihm mehr als acht Tage übersetzt. Und mit Schlöndorff nicht nur Russisch, sondern auch Französisch. Dafür 300 Dollar!
Ich hatte ihn fast jeden Tag aus der Innenstadt in meine südöstlich Berlins gelegene Wohnung abgeholt und abends wieder hingebracht, seine Bezahlung dafür also nicht einmal die Kosten richtig abdecken würden. Seine Antwort war erschütternd. Ich will sie hier nicht weiter ausführen. Aber ich musste ihm natürlich noch einiges sagen.
Als erstes natürlich, dass er kein Buch, Synopsis oder etwas ähnliches vorgelegt hatte.
Er hatte einen Titel in seinen Vorstellungen: Der kasachische Kommandant in einer kleinen deutschen Stadt.
Das ist für mich nicht hinzunehmen. Es wäre eine Verfälschung einer kleinen Episode im Zusammenhang mit dem Großen Vaterländischen Krieg. Ein russischer Kommandant hat meinem Vater das Leben gerettet. Die Khane im heutigen Land haben für seinen Sohn nicht einmal einen Finger gerührt, nein, sie haben bewusst verhindert, dass eine Familienzusammenführung stattfinden kann. Und dafür wollen sie sich mit uns sonnen können? Der kleine russische Major hat Größe und Mut bewiesen. Was haben die Khane getan? Nicht nur nichts – sie haben alles behindert. Und dafür dürfen sie sich nicht feiern lassen. Ohne ein Wort mit mir, ohne Verständigung hat er mich und uns hintergangen und belogen. Ich verstand, deshalb habe ich kein Drehbuch zu sehen bekommen – also vorsätzlich.
Aber ich musste ihn auf etwas viel Gravierenderes aufmerksam machen.
Er schrieb mir, dass er den Film auch ohne mich zu Ende bringen wird. Es sei zwar nicht mehr so einfach.
Hier ein Auszug aus meiner Mail an ihn:
„Was die Rechte am Zeigen des Film- und Fotomaterials anbelangt, dachte ich eigentlich, dass der Direktor eines Filmstudios, der sicherlich Hunderte von Vertraegen dieser Art im Jahr unterschreibt, ueber seine Arbeitsgrundlage bescheid wuesste.
Fuer den Fall, dass Du sie noch nicht kennen solltest, hier eine Kurzfassung, die Du jederzeit bei einem Rechtsprofessor, im Justizministerium oder selbst in der deutschen Botschaft in Almaty genauer erfragen kannst.
Das Recht am eigenen Bild ist Teil des allgemeinen Persoenlichkeitsrechts. Es besagt, dass jeder selbst bestimmen kann, ob ueberhaupt und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veroeffentlicht werden duerfen. Das beinhaltet nicht nur Fotografien oder Filmaufnahmen, sondern jede erkennbare Wiedergabe der Person.
In Deutschland wird die Nichtbeachtung dieses Rechtes mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe belegt. Ausserdem entstehen Schadensersatzansprueche, sogar Schmerzensgeldansprueche sind moeglich. Was dieses Recht anbelangt, besitzt es eine gewaltige Brisanz. Es ist naemlich Teil der allgemeinen Menschenrechte und gilt deshalb fuer jeden Menschen auf der Welt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es unserem Land in irgend einer Weise hilft, eine derartige Diskussion wegen einer Bagatelle, ein Regisseur will unbedingt gegen den Willen eines Abgebildeten einen Film veroeffentlichen, in Gang zu setzen.“
Ich machte ihm deutlich, dass er keinerlei Rechte an diesem Filmmaterial hat.
Ich erhielt meine Fotos wieder zurück. Die Sache war scheinbar beendet.
Die Filme, die ich als Gastgeschenk erhalten hatte, schickte ich den Landsleuten, die in Deutschland leben. Der Vorsitzende der Diaspora freute sich darüber, weil so eine weitere Gelegenheit gegeben war, die Sprache zu pflegen. Dafür erhielt ich Muchtar Auesows „Abai“ von ihm.
Der Akim von Kysylorda wurde inzwischen Kulturminister.
7. Die Khane zeigen ihr Gesicht
Wie ging es weiter? Nun – ich würde es im Jargon ausgedrückt salopp als khanatsmäßig bezeichnen. Konnte ja gar nicht anders sein.
Ich flog am Ende der Zeit wieder nach Berlin. Es war 2007.

Der Präsident, rechts von ihm sein Kulturminister
Nach Hause zurückgekehrt, dachte ich so, meine Frau ist zurückgeblieben. Ich sitze allein in Berlin. Einen Dokumentarfilm sollte es unter solchen Umständen nicht geben. Es gab kein Filmmaterial für diese Geschichte. Im Fernsehen sah ich einen Dokumentarfilm über einen Deutschen aus Berlin, der als israelischer Spion in den 50-er Jahren in Ägypten arbeitete. Er flog auf, saß im Gefängnis, wurde nach 5 Jahren nach Israel abgeschoben, kam mit dem normalen Leben als Beamter im Mossad nicht zurecht. Schließlich ging er nach Deutschland. Irgendwann starb er. Der Film bestand aus den Sentenzen: Sohn geht vor einer Berliner Zeitungsbude hin und her. Sohn geht in Kairo auf einer Straße hin und her, Sohn geht in Jerusalem auf einer Straße hin und her, Sohn geht in einer süddeutschen Stadt auf einer Straße, später in einem Krankenhaus hin und her. Zwischendurch ein paar Zeitungsausschnitte. Aufgelockert wurde das Ganze mit ein paar spärlichen Interviews. So wollte ich es nicht. Spannendes Schicksal, unterhaltsam, interessant, aber keine ordentliche filmische Umsetzung möglich.
Also es musste ein Spielfilm werden.
Ich setzte mich hin und begann meine Gedanken, Empfindungen, die Abläufe, meine Vorstellungen aufzuschreiben.
Wie schreibt man so etwas? Ich ließ den Betrachtungen einfach freien Lauf. Ich fragte einen bekannten Mitarbeiter der Botschaft, ob sie mir dabei behilflich sein würden. Selbstverständlich. Mein Konzept reichte zunächst bis zum Zusammenfinden der Familie. Es war möglich, diese Geschichte in einer freundlichen, mit Humor untersetzten Komödie zu gestalten. Im Laufe der Zeit schrieb ich den Text um, baute einiges hinein, strich anderes.
Als ich wieder nach Almaty kam, dachte ich an den Produzenten, den ich ein paar Jahre vorher in Berlin getroffen hatte. Schließlich fand Rimma nach einigem suchen seine Telefonnummer. Wir trafen uns. Ich gab ihm das Geschriebene und sagte ihm, dass ich an ihn dabei dachte. Später in Kysylorda wartete ich auf seine Nachricht.
Er hatte die Geschichte übersetzen lassen, aber ach, Miramkul meinte, dass das kein Russisch sei und so nicht veröffentlicht werden könne. Wir setzten uns drei Tage hin und gingen alles durch. Am Ende stand ein Text, der die Anfangsphase meiner Familiengeschichte beschrieb. Etwa bis zu meiner ersten Rückkehr nach Berlin. Bis dahin war ja alles fröhlich, schön, man konnte sich darüber freuen. Aber der Produzent signalisierte mir, dass im Lande niemand diese Geschichte verfilmen wird.
Der ehemalige Botschafter ist ins Präsidentenamt gewechselt, der Kysylordinsker Akim war zum Kulturminister avanciert. Der Direktor des größten Filmstudios, dieser Dokumentarregisseur, war verschwunden. Man ließ mir sogar sagen, er sei gestorben, was nicht der Wahrheit entsprach.
Niemand im Land hatte Interesse daran, unsere Geschichte zu verfilmen. Naja, es ist eben so. Ich flog wieder nach Berlin. Von hier aus war ebenfalls niemand zu diesem Projekt zu bewegen.
Natürlich hatte ich die Leute im Sinn, von denen ich schon etwas gesehen hatte, was mir gut gefallen hatte. Man kann sich denken, die einen sind ins Ausland gegangen, die Anderen waren nicht mehr auffindbar. Selbst der schon erwähnte Kameramann war nicht mehr da.
Das erinnerte mich an eine Erfahrung, die ich früher schon machte. Eine Bekannte aus Dresden besuchte mich Mitte der 80-er Jahre in Berlin mit ihrem Freund, einem Maler. Ich fragte ihn, wo er sich einordnen würde. Seine Antwort: Bisher war ich nur zweite Stufe. Jetzt, da aus der ersten Stufe die meisten einen Ausreiseantrag gestellt haben, steige ich zu den Besten auf. Nicht, das ich besser werde, nein, die Besten gehen in den Westen.
Das Jahr 2009 wurde zum Jahr des zentralasiatischen Landes in Deutschland. Der Botschafter erläuterte in der Presse, dass über 100 Veranstaltungen dazu stattfinden werden. Als das Jahr begann, kam der Präsident und eröffnete das Jubeljahr gemeinsam mit dem damaligen deutschen Bundespräsidenten. Ich erhielt eine Einladung der Botschaft. Ich fragte meine Mutter, ob sie mitkommen möchte. Sie war begeistert von dem Gedanken. Ich schrieb der Botschaft, dass ich mit meiner Mutter zu der Veranstaltung kommen möchte, bitte aber um Berücksichtigung, dass sie über 80 Jahre alt und schwerbehindert sei. Wir erhielten Karten für den zweiten Rang. Höher ging es nicht, Aufzugeinrichtungen gab es nicht. Von oben sah ich die Honoratioren, das diplomatische Völkchen, alles schön geordnet. Nach dem Ende der Veranstaltung sagte meine Mutter, dass sie nicht am Empfang teilnehmen könne und nach Hause müsse, da ihre Beine wehtun.
Einige Wochen später las ich im Berliner Tagesspiegel einen Artikel über den hier ansässigen Diplomatenclub. Der Journalist überschlug sich fast vor Begeisterung und gebrauchte Worte wie gute Verhältnisse unter den Mitgliedern, geradezu freundschaftlich. Und zum Beweis führte er an, dass die Frau des Botschafters des zentralasiatischen Landes spontan alle ihre Freunde zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte. Aha, ich dachte an meine Mutter.
Ich entschied mich, dem Präsidenten einen Brief zu schreiben. Ich legte dieses Filmprojekt bei, den E-Mail- Verkehr mit dem Regisseur als Begründung dafür, warum ich die Filmarbeiten abgebrochen hatte, schrieb darüber, dass seine Funktionäre eine einmalige Familiengeschichte mit einer Zusammenführung verhindert haben, sie keinerlei Interesse daran hatten, irgendetwas für uns zu tun. Ja, dass sie das alles verhindert haben. Keine Reaktion – nichts.
Konsequenterweise erhielt ich zu keiner weiteren Veranstaltung, die die Botschaft organisiert hatte, eine Einladung. Nicht nur, dass die Khane uns keine Möglichkeit der Familienzusammenführung gaben, nein, sie hatten mich nunmehr zur Persona non grata gemacht. Wenigstens war das konsequent.
Der Verein lud nur zu einer einzigen Veranstaltung in diesem Jahr ein. Da traf ich einen Mitarbeiter des Kulturministeriums mit dem beziehungsvollen Namen Abai aus Astana. Der fragte mich schließlich, ob ich zu der Abschlussveranstaltung im Dezember komme. Diese Frage stellten mir andere ebenfalls. Meine Antwort war natürlich nein. Warum nicht? Die Botschaft lädt mich zu nichts mehr ein. So hat sie es weiter gehalten.
Ich blickte zwar jedes Mal in verwunderte Gesichter, aber es entsprach den Tatsachen. Land, Regierung, die Nation feiern sich, da haben Schicksale wie meines nichts zu suchen.
Der Präsident ließ sich wieder wählen.
Zwei Jahre nach dem ersten Brief schrieb ich den Präsidenten erneut an.
Es meldete sich das Kulturministerium. Der Stellvertretende Minister schrieb mir, dass sie vom Präsidenten beauftragt sind zu prüfen, ob das Filmstudio meinen Film realisieren könne. Er besteht aber darauf, dass vorher der Dokumentarfilm fertig gestellt wird. Meine Antwort war eindeutig, dass dieser Film nicht fertig wird. Ich legte ihm den Mailverkehr mit dem Regisseur bei. Er konnte selbst sehen, was passiert war. Außerdem bat ich darum, dass das Filmmaterial entweder vernichtet wird und ich ein Protokoll darüber erhalte oder sie es mir zuschicken. Es ist mein gutes Recht.
Etwas später schrieb mir der Direktor der Migrationspolizei, ich solle mich in der Botschaft zwecks Ordnung der Papiere melden, die für eine Übersiedlung ins Land notwendig würden. Ein Vizekonsul der Botschaft schrieb mir in der gleichen Post eine Schwarz-weiß-Kopie eines an mich gerichteten Schreibens mit der gleichen Forderung. Ich antwortete, dass die Zeit für eine Übersiedlung für mich und damit eine Familienzusammenführung abgelaufen war. Meine Mutter ist über 80 Jahre alt, lebt allein in Berlin, da kann ich nicht in ein anderes Land übersiedeln. Und so formulierte ich, dass ich nur noch zwei Wünsche habe:
1. möchte meine Mutter eine Ehrung erfahren und
2. ich habe Schwestern, die unter sehr schwierigen Umständen leben müssen und niemals allein da heraus kommen werden. Deshalb wünsche ich mir für sie eine Besserung der Lebensumstände. Ich bin das Familienoberhaupt, es wäre meine Pflicht gewesen. Ich hatte mich bemüht, aber ich bekam keine Gelegenheit dafür.
Das sind meine Intentionen. Selbstverständlich erhielt ich keine Antwort.
Kommen wir auf das Kulturministerium zurück. Ich erhielt von einem Vizekulturministerminister ein Schreiben, dass die nationale Gesetzgebung die Herausgabe des Filmmaterials oder eine Vernichtung verbiete. Rechte daran haben schließlich die Geldgeber (? war ich durch das Tragen von Kosten für diese Aufnahmen doch ebenfalls) und der Regisseur, der durch die künstlerische Gestaltung diese Rechte daran hat. Verwiesen wird dabei auf internationale Gesetze, die in die nationale Gesetzgebung eingeflossen waren, also dem Stand entsprechen würden.
Anfangs wollte ich eine Antwort schicken, ich ließ es sein.
Ich wurde gefragt, ob ich das Material einfach einklagen möchte. Ein Risiko dafür gäbe es nicht.
Ich habe nein dazu gesagt.
Die haben Filmmaterial über mich, welches meine Persönlichkeitsrechte und somit die angrenzenden Rechte verletzt. An Unrecht kann niemand Rechte erwerben. Das gilt international, nur in diesem zentralasiatischem Land nicht.
Hier endet diese Erzählung - vorläufig.
Über 15 Jahre ziehen sich die Ereignisse nach meiner ersten Initiative zur Findung der Familie nach dem Zusammenbruch des östlichen Systems hin.
Selbstverständlich habe ich eine Menge an Episoden, lustiger, trauriger, banaler Art weggelassen. Da niemand einen Film daraus machen möchte, werde ich das Ganze zu einem Buch verarbeiten. Die Botschaft hier in Berlin hatte das Buch eines Deutschen von dort, der vom Bundespräsidenten dafür mit einem Orden bedacht wurde, welches ein ungünstiges Licht auf die Gesellschaft warf, sponsern lassen. Auf die Frage, warum ich mit einem solchen Hintergrund für mein Schreiben nicht gesponsert werde: Weil Du keinen bekannten Namen hast.
In diesem zentralasiatischem Land leben Angehörige von über 100 verschiedenen Nationen. Das Land ist stolz auf das friedliches Zusammenleben der Völkerschaften. Das ist die offizielle Version. Wie soll man das glauben, wenn selbst solche Schicksale wie unseres, also originär der eigenen Nationalität zugehörig, von der Führung ignoriert werden?
Ein Mensch wie der Abgeordnete aus Kysylorda, der sich bewegt und herzlich zu uns äußerte, der eine kleine Fernsehsendung im Regionalfernsehen mit dem Titel „Menschen unserer Stadt“ ermöglichte, bildet dabei eine Ausnahme in diesem Geschehen. Ihm möchte ich für seine Haltung danken.
Den wahren Rückhalt fand ich bei den vielen einfachen Leuten, die ich traf.
Selbst hier in Deutschland freuten sie die Leute mit uns. Da jeder davon ausging, dass es eine wunderschöne Familienzusammenführung geben wird, betrachteten sie das zentralasiatische Land mit großem Wohlwollen. Das hat sich nunmehr geändert. Den Glanz vom zentralasiatischen Land haben die Khane selbst entfernt.
Dem Establishment war und ist unser Schicksal gleichgültig, manchmal habe ich gestört – und deshalb heißt diese Geschichte „Das Khanat“. Diese Haltung ist Khanen würdig.
Und ganz zum Schluss:
Jetzt im Februar 2012 steht wieder ein Besuch des Präsidenten in Berlin an. Er wird von der Bundeskanzlerin, dem Bundespräsidenten empfangen, man führt wichtige Gespräche, sicher werden Abkommen abgeschlossen, die Presse wird mehr oder weniger berichten.
Der Präsident eines Landes, das einen solchen einzigartigen Fall nicht zu einer Familienzusammenführung bringen wollte, besucht die Kanzlerin eines Landes, das fast eine Million Deutsche aus seinem Land eingebürgert und integriert hat.
Wie wird er sich dabei vorkommen?
Berlin, Januar 2012
Aul
Aul ist in Zentralasien die Bezeichnung für Siedlungen und Dörfer.
Khanat
Ein Khanat ist die zentralasiatische Entsprechung des europäischen Mittelalters, also Feudalabsolutismus mit all seinen Erscheinungen.
Selbstverständlich gibt es in ausgeprägter Form Nepotismus.
Hinzuweisen ist in diesem Falle noch darauf, Wesen und Erscheinung nicht miteinander zu verwechseln.
Sultan Suleiman der Prächtige führte vor über 500 Jahren im Osmanischen Reich ein, dass sich jeder Untertan an den Herrscher wenden und mit einer Antwort rechnen konnte. So weit ist die Entwicklung in diesem zentralasiatischen Land noch nicht gediehen, wie hier nachzulesen ist.
Koscha
In der „Neue Fischer Weltgeschichte“ Band 10 (S. Fischer Verlag 2012) – Zentralasien - von Jürgen Paul, ein Buch, um das keiner herumkommt zu lesen, der sich mit zentralasiatischen Themen befasst, ist über die Koscha Folgendes zu lesen:
„Mancherorts sind Abstammungsgruppen zu beobachten, die ein besonderes Prestige genießen. Sie leiten sich vom Propheten Muhammad ab (dann sind sie Saiyid) oder von einem der ersten vier Kalifen oder von einer anderen bedeutenden Figur der islamischen Geschichte, vorzugsweise, aber nicht ausschließlich, einer arabischen.“ … „In Kasachstan sind Qoža – (von pers. Khwaja „Lehrer“) Gruppen prominent, die offenbar in der Vergangenheit als Wächter von Schreinen bzw. als Nachkommen sufischer Meister bekannt waren. (und deshalb als religiöse Spezialisten wirken konnten). Auch sie führten später ihre Abstammung auf den Kalifen Ali b. Abi Talib (656 -661) zurück und galten daher nicht als Kasachen; ähnlich wie die Abkömmlinge Činngis Khans standen sie als „Weißer Knochen“ außerhalb der tribalen Ordnung. Dabei unterscheiden sich diese Abstammungsgruppen in der Sprache und auch sonst nicht von den übrigen Turkmenen, Kasachen usw. Alle diese Abstammungsgruppen führten Genealogien in schriftlicher Form und tun dies teilweise heute noch (in arabischer Schrift). Sie waren weitgehend endogam, sie gaben ihre Töchter nicht an Außenstehende. Heute genießen sie teilweise noch einen gewissen Respekt, man fürchtet ihren Zorn und traut ihnen eher als anderen religiöses Charisma zu.“
Das zentralasiatische Land
Ja, bei dem zentralasiatischen Land handelt es sich um Kasachstan.
A
Abai – eigentlich Ibrahim Qunanbajuly
Abdurachman
Aitmatow, Dschingis
Alexej
Ali
Almachan
Amentai, Didar
Anuar
Asimov, Sergej
B
Buribaev
D
Drosd, Wolodymyr
E
Erler, Gernot
Eva
G
Gaip, Iran
Gauss, Günter
Grund, Manfred
J
Jassauiy
K
Kalizhanuly, Kalizhanov
Kul-Muhammed, Muchtar
M
Menlibaeva, Almagul
Metger, Jörg
Miramkul
Mohammed
Mukhamedzhanov, Kaltai
Muratov, Baurzhan
N
Nasarbajew, Nursultan
Nuralijew, Anipa
Nuralijew; Amentai
Nussupov, Bolat
O
Omarova, Gulshat
Orasalin, Nurlan Myrkasemowitsch
P
Petersen, Herta
Platon
R
Rothe, Fanny
Rothe, Max
S
Sarybai, Kairat
Schlöndorff, Volker
meine Schwestern Alija, Ak-Bajan, Aida, Bella, Mira, Rimma, Rita, Rosa, Sweta
Sere
T
Thomas, Dr. Ingrid
W
Wegener, Hedi
Z
Zschorn, Dr. Eva-Maria